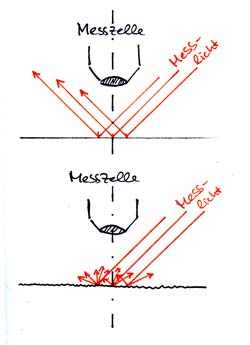Kolumne
Thomas Wollstein
Oktober 2004
…, innerhalb dessen ich mich fotografisch ausleben kann, ist in letzter Zeit enger geworden. Gleiches gilt für die Zeit, die zum Schreiben übrig bleibt. Sie werden das als Leser auch schon gemerkt haben, sowohl hinsichtlich der Länge meiner Artikel als auch hinsichtlich der fachlichen Tiefe. Ich hoffe, Ihnen aber trotzdem noch das eine oder andere Lesenswerte bieten zu können, und wenn ich Ihnen eines Tages nichts Neues mehr zu sagen habe, aber noch nicht mit dem Schreiben aufgehört habe, zwingt Sie ja keiner, diese Kolumne weiter zu lesen. Doch noch steht das Angebot.
Der „Rahmen“ in der Überschrift ist als Thema dieser Kolumne der Vergrößerungsrahmen.
Mein erster Vergrößerungsrahmen war einer für das Format 13x18 von Rowi, den ich mit einer Grundausstattung bekam, die aus einem soliden Meopta-Vergrößerer, drei Schalen 18x24, einer Tüte Fixiersalz (Die Veteranen unter Ihnen kennen Sie noch, die quadratischen gelb-roten Tüten) und einer Flasche Neutol NE sowie einer 100er-Packung TuraSpeed-Papier im sagenhaften Format 7x10 – cm wohlgemerkt! – bestand.
7x10 wurde mir schnell zu klein, und später auch 13x18. Lange Zeit habe ich danach ohne Vergrößerungsrahmen gearbeitet und randlos, zumeist auf gutmütigem, ohne weiteres Zutun hinreichend plan liegendem PE-Papier, vergrößert.
Danach kam, u.a. beeinflusst durch den Besuch einer Ausstellung von Henri Cartier-Bresson, eine Zeit, während der ich meinte, es gehe nichts über die Vergrößerung des gesamten Negativs einschließlich des unbelichteten (im Positiv dann schwarzen) Randes.
Damit haben wir die beiden wesentlichen Aufgaben eines Vergrößerungsrahmens auch schon erwähnt:
- Er hält das Papier plan und
- er definiert den Ausschnitt und liefert einen sauberen weißen Rand (ggf. um einen schwarzen Negativrand herum).
Für die, die dem Rotfilter zur Papierausrichtung nicht trauen, kommt noch
- die Funktion des Platzhalters zum Einstellen hinzu, d.h. der Rahmen muss einigermaßen rutschsicher sein.
Das klingt einfach genug, und man sollte meinen, ein Zubehörteil, das das leistet, wäre für relativ kleines Geld zu bekommen.
Dem ist leider nicht so, wie man leicht feststellt, wenn man Kataloge wälzt und die Preise für Vergrößerungsrahmen anschaut. Woran liegt das? Schließlich handelt es sich doch nicht um ein feinmechanisches Produkt oder eines aus wertvollen Materialien.
Am besten verstehe ich noch, dass es relativ aufwendig sein könnte, verschiebbare Maskenbänder mit einer solchen Präzision zu fertigen, dass die Bänder immer – auch nach Jahren der Benutzung – senkrecht aufeinander stehen; denn das ist eine grundlegende Anforderung: Die Bildbegrenzung muss rechteckig, nicht schiefwinklig sein.
Aber ist das der Grund für die hohen Preise?
Es gibt schon eine Reihe von Leistungsmerkmalen bei zumeist teureren Vergrößerungsrahmen, die einem das Leben in der Duka erheblich erleichtern können. Dazu gehört z.B. eine Möglichkeit, den Rahmen in offener Stellung stehen lassen zu können und damit beide Hände zum Einlegen des Papiers frei zu haben.
Wie dem auch sei: Ein geiziger Freund, seines Zeichens bekannter Master-Printer, verwendet seit Jahren als Vergrößerungsrahmen Papprahmen. Er schneidet einen dreischenkligen Rahmen für das grundlegende Format. Den Ausschnitt legt er dann fest, indem er unter dem Vergrößerer schaut, was mit aufs Bild soll und was nicht und danach die vierte Seite nach genauer Nachmessung mit einem Tacker fixiert.
Ich fand die Idee zunächst angesichts des günstigen Preises brillant, musste allerdings schnell feststellen, dass sich bei dickerer Pappe an den Ecken durch unter den Rahmen fallendes Licht (Schließlich liegt irgendwo immer ein Schenkel des Rahmens auf einem anderen.) unschöne Effekte entstehen können. Dünne Pappe auf der anderen Seite hatte den Nachteil, dass sie so instabil war, dass die Handhabung wenig Spaß machte, weil ständig der Vergrößerungsrahmen verknickt war.
Ich habe die Idee für mich also schnell wieder ad acta gelegt und war wieder auf der Suche nach bezahlbaren Systemen. Dabei gelangte ich durch PHOTOTEC und eine Bekannte, die das ihren durchaus hochwertigen konventionellen Vergrößerungsrahmen bei ebay verscheuerte, nachdem sie einen Versamask-Rahmen ausprobiert hatte, irgendwann an Herrn Zöpfl und sein Produkt.
Das System ist schnell erklärt: Versamask besteht aus einem Grundbrett (in zumindest zwei verschieden großen Ausführungen) mit Bohrungen für Passerstifte und festen, d.h. unverstellbaren, pulverlackierten Stahl-Maskenrahmen, die auf dem Grundbrett durch je 8 Passerstifte festgehalten werden.
Das Fotopapier wird zwischen die Passerstifte gelegt und liegt dort unverrückbar. Dann wird darauf der Maskenrahmen gelegt, der dank seines hohen Gewichts auch störrisches Barytpapier hinreichend plättet. Ein Bild des Systems sehen Sie auf der Versamask-Homepage www.versamask.de.)
Wenn Sie sich wie ich in meiner Anfangszeit über die krummen Maßangaben auf den Fotopapierschachteln gewundert haben (Wer kommt schon auf 17.8 cm?): Die weitaus meisten Papierhersteller halten sich an das Zoll-System, und das auch sehr genau. Der Versamask ist darauf eingeschworen, d.h. die Bohrungen für die Passerstifte passen zu den üblichen Formaten. (Zu Ausreißern unten noch ein Wort.)
Die Vorteile eines solchen Systems sind klar:
- Die Ränder sind auch nach Jahren der Nutzung immer noch präzise rechtwinklig, da keine Verschleißteile vorhanden sind.
- Ausschnittposition auf dem Blatt und Rahmenbreite sind immer gleich, d.h. keine Abweichungen durch Verstellung oder Ungenauigkeiten beim Einlegen des Papiers.
Die Nachteile aber auch:
- Geringe Flexibilität hinsichtlich Ausschnitt- und Papiermaßen, da Rahmenabmessungen und Bohrungsabstände fix sind. (Dazu aber unten noch mehr.)
- Für jedes Format ein Rahmen nötig, das treibt die Kosten.
- Sie brauchen Ablageplatz für die Rahmen.
- Die Handhabung ist nicht ganz so bequem wie bei einem Vergrößerungsrahmen, der durch eine Gasfeder offen gehalten wird.
Da Herr Zöpfl so nett war, mir eine Test-Ausstattung zur Verfügung zu stellen, möchte ich Ihnen meine Erfahrungen mit dem Versamask-Vergrößerungsrahmen nicht vorenthalten.
Zunächst der allgemeine Eindruck: Alle Teile sind solide und präzise gearbeitet. Die Passerstifte weisen praktisch kein Spiel in den Bohrungen des Grundbretts und der Maskenrahmen auf. Das Grundbrett ist solide und schwer, was dazu führt, dass es ziemlich unverrückbar auf dem Grundbrett des Vergrößerers liegt. Leichtes Anstoßen birgt also nicht die Gefahr, dass der Ausschnitt nicht mehr stimmt.
Das Grundbrett ist mittel- bis dunkelgrau (etwa im Ton einer Graukarte) lackiert. Das macht es erforderlich, zur Scharfstellung und Ausschnittwahl ein weißes Blatt Papier aufzulegen. Es empfiehlt sich, dazu ein unentwickeltes, aber ausfixiertes und ausgewässertes Blatt Fotopapier im Zielformat zu nehmen, damit man es genau wie das nachher zu belichtende Blatt einlegen und mit dem Maskenrahmen abdecken kann. Nehmen Sie hierfür am besten PE-Papier, denn Barytpapier ändert mitunter bei der Nassverarbeitung durch Quellung seine Maße so sehr, dass es nicht mehr zwischen die Passerstifte passt.
Es gibt Leute, die behaupten, man solle sowieso immer nur auf ein Blatt Fotopapier fokussieren, um beim Scharfstellen die Papierdicke zu berücksichtigen. Aus meiner Sicht überschätzen diese Leute ihre Genauigkeit beim Scharfstellen. Es gibt auch Leute, die behaupten, der Vergrößerungsrahmen müsse mattschwarz lackiert sein, um eine Verschleierung des Papiers durch Reflexionen durchgetretenen Lichts zu vermeiden. Dazu habe ich in meinem Artikel vom September 2001 (Grauschleier) schon etwas gesagt.
Die Maskenrahmen sind schwarz lackiert und recht schwer. Es gibt sie in den verschiedensten Standardformaten ab 10/15 aufwärts, quadratisch, für schmale Ränder (5 mm, heißt hier NF für Normalformat) oder für Bilder, die nach der Klebebandmethode (oder meinem Klemmverfahren) getrocknet werden sollen (heißt hier Baryt), für quadratische Bilder (Mittelformat, heißt hier QF) und auch für verschiedene Platzierungen des Bildausschnitts auf dem Blatt (zentriert oder nach oben versetzt mit breitem weißen Rand, zentrisch oder nach oben versetzt; heißt hier Schmuckrand-Maske [SR]). Auf Wunsch werden auch gegen entsprechenden Aufpreis Masken nach Nutzerwünschen einzeln angefertigt.
Richtig schön für die Fans scharfer schwarzer Ränder ist, dass es auch Abdeckbleche gibt, die es gestatten einen schwarzen Rand einzubelichten. Dazu gibt es zu den Masken Abdeckbleche, die etwas kleiner sind als die Bildausschnitte der entsprechenden Maskenrahmen. Sobald man sein Bild belichtet hat, legt man das Abdeckblech in den Maskenrahmen und achtet darauf, dass es zunächst in der linken unteren Ecke gut anliegt. Dann schaltet man für einige Zeit das Raumlicht ein. Als nächstes legt man das Abdeckblech rechts oben an. Eine Darstellung des Verfahrens sehen Sie unter www.versamask.de/randtechn.htm
Der Versamask lässt sich auch für Kontaktkopien benutzen, siehe dazu www.versamask.de/kontaktkopie.htm
Bevor Sie sich noch fragen, warum ich nicht gleich den Artikel auf die Aussage „siehe www.versamask.de“ beschränke, noch ein paar Anmerkungen, die Sie dort nicht finden werden.
Kann man die Versamask verbessern?
Nachdem mir Herr Zöpfl ein Testset zur Verfügung gestellt hatte und ich es ausgiebig getestet hatte, kamen mir ein paar Anregungen für Verbesserungen:
Die Gummifüßchen des Grundbretts sollten aus meiner Sicht durch Gummileisten ersetzt werden. Warum? Ihr Abstand ist genau so groß, dass meinem Vergrößerer je nach Ausschnitt nicht mehr alle viere auf dem Grundbrett Platz finden. Dann steht der Rahmen nicht mehr horizontal. Das würde bei Gummileisten nicht passieren.
Anmerkung der Redaktion: die neueste Generation der Grundbretter besitzt statt der Füßchen diagonal aufgeklebte Moosgummistreifen.
Die Passerstifte sind aus mattglänzendem Stahl gefertigt. Da das Papier exakt an ihnen anliegt, kann es offenbar unter bestimmten Bedingungen – am ehesten bei der Schmuckranderzeugung mit Raumlicht – trotz der wirklich passgenauen Bohrungen im Maskenrahmen dazu kommen, dass sich im Bereich der Passerlöcher Lichteinbrüche ergeben, die winzige schwarze Flecken auf dem Papier hervorrufen. (Bei mir ist das nicht aufgetreten, wohl aber bei einer Bekannten – Danke für den Hinweis, Sandra.) Dem ließe sich durch Schwärzen der Stifte vorbauen.
Anmerkung der Redaktion: Seit Mitte 2005 werden mit der Versamask schwarz-verzinkte Stifte geliefert.
Schließlich noch ein paar Workarounds, um die Flexiblität des Systems zu erhöhen:
Abweichende Papierformate:
Forte-Papier, bei vielen wegen seines günstigen Preises und seiner guten Qualität sehr geschätzt, büxt aus dem Zoll-System aus. 24x30 ist bei Forte z.B. 24x31. Das ist aber kein Problem: einfach die Passerstifte an einer Langseite weglassen und dafür das Papier sorgfältig zwischen die verbleibenden 6 Stifte schieben. Sie haben dann auf einer Seite 1 cm mehr Rand, was aber kaum stören dürfte.
Weichen zwei Abmessungen des Papiers ab, kann man den Rahmen erfahrungsgemäß mit 4 Passerstiften (z.B. 2 oben und 2 rechts) immer noch einigemaßen verwenden, aber das macht wenig Spaß. Dann macht es bei hinreichend stabiler Vorliebe für ein solches Papier eher Sinn, sich einen Wunschrahmen anfertigen zu lassen (oder einen geschickten Menschen im Bekanntenkreis zu bitten, einen existierenden anzupassen).
Abweichende Wunschformate ohne Sondermasken:
Die Versamask eignet sich hervorragend für eine Kombination mit meinem eingangs erwähnten Passepartout-System. Wenn Sie sich aus dünnem schwarzen Fotokarton ein Passepartout schneiden, dessen Außenmaße genau dem verwendeten Papier entsprechen und das die kleinere Innenmaße aufweist als der Maskenrahmen, dann lässt sich ein solches Passepartout hervorragend auf das Papier und der schwere Maskenrahmen obendrauf legen. So können Sie beliebige leicht abweichende Formate erzeugen. Sie müssen nur genau genug schneiden können.
Herr Zöpfl wird mich sicher für diese Idee verfluchen und mir vorwerfen, die Ränder eines solchen Passepartouts seien nicht sauber genug, aber meine Erfahrung zeigt, dass bei guter Schnitttechnik und scharfem Messer ganz prima Ränder möglich sind.
Übrigens muss man gar nicht ganze Passepartouts schneiden: Man kann auch ein Rechteck aus Fotokarton schneiden, das unten an zwei Passerstiften anliegt und einen Teil des Bildausschnitts verdeckt und so den Rand an einer Seite (meist unten) vergrößert. Auf diese Weise lassen sich mit einer Grundausstattung von Versamask-Maskenrahmen auch ziemlich ausgefallene Formate erzeugen.
Fazit
Ich komponiere meine Bilder mit der Kamera vor dem Auge, was bedeutet, dass ich in den allermeisten Fällen sowieso das ganze Format auf dem Papier sehen will. Nur in den Fällen, wo ich in der Standortwahl nicht frei bin und dann doch am Rand Details ausblenden möchte, brauche ich die beschriebenen Abdeckpappen aus Fotokarton. Von daher kann ich gut mit festen Maskenmaßen leben. Mein Eindruck ist, dass ich da nicht allein bin, sondern dass viele Fotografen eine starke Präferenz für bestimmte Formate haben und nicht von Bild zu Bild wechseln. Dann ist die Versamask ideal.
Der Versamask ist nicht die konkurrenzlos billige Lösung aller Probleme – jedenfalls dann nicht, wenn man sich für alle denkbaren Fälle ausrüsten will. Er kann eine recht kostengünstige und dabei doch noch flexible Sache sein, wenn man eine Grundausstattung anschafft und mit Fotokarton nach Bedarf ergänzt.
Die Lage ist ernst – aber nicht hoffnungslos!
Kaum hatte ich meinen Test abgeschlossen (das war schon im Frühjahr der Fall), da teilte mir Herr Zöpfl mit, dass er die Herstellung des Versamask demnächst aus gesundheitlichen Gründen einstellen wolle. „Sch…!“ , dachte ich, „Da findet man mal eine Sache, die man guten Gewissens empfehlen kann, und dann gibt’s ausgerechnet die nicht mehr.“ Inzwischen gibt es im Wesentlichen noch Restbestände vom Versamask. Aber es scheint, die Lage ist nicht hoffnungslos: Heiland electronic hat seine Bereitschaft erklärt, das System zukünftig zu fertigen. Es sind noch nicht alle Fragen geklärt und es wird sicher nicht sehr schnell möglich sein, die Fertigung wieder aufzunehmen. Rechnen Sie also bitte mit einer "Versorgungslücke" in den nächsten Monaten. Vertrieben wird das System auch zukünftig exklusiv von PHOTOTEC.
Anmerkung der Redaktion: Versamask seit Ende 2010 eingestellt (Versamask)
Zu guter Letzt möchte ich Herrn Zöpfl danken, dass er mir angeboten hat, meine Testausstattung bei Nichtgefallen zurückzunehmen und mir, als sie mir doch gefiel, einen recht günstigen Preis angeboten hat, ohne zu wissen, was ich schreiben würde und obwohl ich die zuvor verabredete Leihfrist weit überschritten hatte. Er hat mich zu keiner Zeit in irgendeiner Weise beeinflusst, sondern schien auf meine Meinung, sei sie nun positiv oder negativ, einfach nur neugierig.
Eine spannende Angelegenheit (die zweite Hälfte)
Thomas Wollstein
September 2004
Als ich die erste Version dieser zweiten „Rate“ des Artikels zu schreiben begann, wollte ich das nach klassischer Art eines Kochrezeptes tun:
Sie brauchen … Nehmen Sie diese Zutat und verfahren Sie damit wie folgt… usw.
So wäre das ein sehr umständlicher Artikel geworden, den zu schreiben und zu lesen viel Zeit gekostet hätte. Zeit ist Geld, und Geld hat niemand übrig, der fotografiert. Also machen wir es anders:
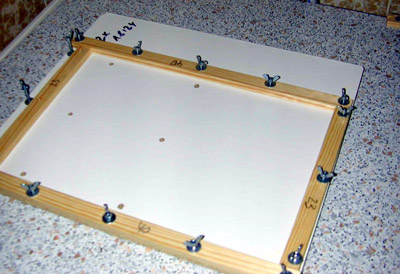
Das ist sie, die Lösung aller meiner Trockenprobleme. Damit ist denn auch schon das Meiste gesagt. Ein paar wenige Erläuterungen mögen denen unter Ihnen, liebe Leser, die – wie ich – die Neigung vieler deutscher Männer zur Heimwerkertätigkeit nicht in den Genen haben, helfen, das Bild besser zu verstehen und meine Trockenvorrichtung nachzubauen.
Keine Angst: Man muss kein Feinmechaniker sein, um diese Aufgabe zu lösen. Ich habe alle Löcher freihändig angezeichnet und gebohrt, die Holzprofile ebenfalls nach lockerem Markieren mit einem Bleistift freihändig gesägt usw. Nichts davon erfordert Millimetertoleranzen.
Besorgen Sie sich
- ein paar kunststofflaminierte Faserplatten. Die, die Sie vielleicht bisher für die Nassklebebandmethode verwendet haben, sind prima. Sie sollten ein wenig größer sein als das zu trocknende Format. (Wie viel „ein wenig“ ist, dazu gleich mehr.) 8 mm starke Platten scheinen mir günstig, bei kleinen Formaten tun’s sicher auch 6 mm, bei riesengroßen vielleicht lieber 10 mm.
- Holzprofile, z.B. 10x20 mm. Es muss kein teures Holz sein, Kiefer tut’s. Nadelholz ist zwar Dank seines Gehalts an Harz und Terpenen im Hinblick auf Archivsicherheit kein gutes Material für ein Regal, in dem man Fotos lagert, aber man muss m.E. keine Langzeitschäden befürchten, wenn man die Fotos für ein paar Stunden damit in Kontakt belässt, zumal nicht, wenn das nur am Rand geschieht. Aber wer ganz sicher gehen will, kann auch Metallprofile benutzen. Die sind allerdings schlechter mit haushaltsüblichen Mitteln zu bohren und zu sägen.
- eine Menge Schrauben, z.B. M4x40. Es sind wirklich eine Menge: für 2 Bilder 18x24 (s. Bild) brauche ich 16 Stück. Ich empfehle den Kauf nach Gewicht, da das meist billiger ist. (S. auch Anmerkung unter Muttern.)
Es sollten Schrauben ohne Rund-, Linsen- oder sonstige Sonderköpfe sein. Sechskantköpfe oder platte Köpfe mit Schlitz sind fein.
Die Länge der Schrauben ergibt sich wie folgt: Plattendicke + Holzprofildicke (die kleinere Abmessung) + Dicke von zwei Unterlegscheiben + etwas Platz zum Aufschrauben der Mutter. - entsprechende Unterlegscheiben, zwei je Schraube. Aber die Dinger sind eh Massenware, so dass Sie sie i.d.R. nur in 100er-Packungen oder nach Gewicht kaufen können.
- ebenfalls „jede Menge“ Muttern. Wenn Sie Schrauben und Muttern abgezählt und abgepackt kaufen, haben Sie gleich alles passend, aber meist teurer. Und es gibt so noch einen Nachteil: Sie bekommen Sechskantmuttern. Luxuriöser und – Sie ahnen es – etwas teurer, sind Flügelmuttern. Die haben dann den Vorteil, dass Sie sie besser ohne Werkzeug anbringen können.
Das ist es schon an Material.
Noch ein paar Tipps zum Aufbau:
Lochabstand
Bei wesentlich mehr als 10 cm hatte ich häufig Probleme damit, dass die Bilder beim Trocknen zwischen den Schrauben unten den Holzprofilen herausrutschten. Ab etwa 8 cm trat das Problem nicht mehr auf. Bei kleinen Abständen tritt ein anderer Effekt auf: Sie drehen am Rädchen – oder besser: an der Mutter. Sie müssen so viele Muttern aufschrauben, dass Sie verrückt werden.
Wichtig ist es, jeweils nahe den Enden der Leisten Löcher vorzusehen.
Formate und Profillängen
Eines zu Anfang: Kommen Sie nicht auf den Gedanken, auf Gehrung schneiden zu wollen. Das ist wirklich vergebene Liebesmüh und verhindert die Doppelnutzung einer großen Spannvorrichtung für zwei kleine Bilder.
Mit bestimmten Standardlängen von Holzprofilen lassen sich viele Formate abdecken. Betrachten Sie das eingangs gezeigte Bild: Bei meinen Profilen 10x20 mm reichen 3 Profile mit 23 cm und 2 mit 40 cm für 2 Bilder im Format 18x24 cm. Mit 2 Profilen à 23 cm und 2 à 40 cm spanne ich Bilder im Format 24x30 cm ein. (Dafür ist die auf dem Foto sichtbare außermittige Lochreihe gedacht.)
Daran sehen Sie auch schon, wie der Hase läuft: Der Abstand zwischen den Lochreihen auf der Grundplatte muss relativ genau (s. aber auch oben über Genauigkeit) den Bildabmessungen entsprechen. Wenn man davon ausgeht, dass 5 mm vom Bild unter den Holzprofilen eingespannt sein müssen, können Sie ein 20 mm breites Holzprofil mit einem 5- oder 6-mm-Bohrer nach Augenmaß in der Mitte durchbohren und können auf jeder Seite ein Bild unterklemmen.
Ich halte folgende Längen vor:
- 23 cm: für 18x24 cm, 24x30 cm
- 29 cm: für 24x30 cm, 30x40 cm
- 40 cm: für 2 x 18x24 cm, 40x50 cm
- 50 cm: für 40x50 cm
Für andere Formate können Sie sich jetzt, glaube ich, den Rest denken.
Zum Vorgehen
Sägen Sie sich aus den Holzprofilen, die Sie im Baumarkt meist in Längen von 2 bis 3 m erhalten, Stücke der gewünschten Länge zurecht. (Oder lassen Sie das den freundlichen Herrn im Baumarkt gleich machen; oft geht das sogar kostenfrei.)
Bohren Sie sich ein paar Profile wie folgt: Je ein Loch an den Enden, dann verteilen Sie auf den Abstand dazwischen so viele Schrauben, dass sich zwischen je 2 Schrauben ein Abstand von 7 bis 8 cm ergibt. Es ist ratsam, alle Profile von gegebener Länge zu bohren, indem Sie das erste fertig gebohrte als Lehre nehmen. Wenn Sie dann mit einem 6-mm-Bohrer Löcher für 4-mm-Schrauben bohren, müssten eigentlich die Profile eigentlich gut untereinander austauschbar sein, d.h. ein gegebenes Profil passt nicht nur zu einem bestimmten Brett.
Nutzen Sie die fertigen Profile als Bohrlehre für die Bretter.
Fertig!
Einfach, nicht wahr?
Jetzt noch drei Worte zur
Anwendung
Bei der Klebebandmethode merkt man, dass die Papiere eine erhebliche Spannung aufbauen. Lassen Sie sich dadurch nicht verleiten, die Schrauben bzw. Muttern anzudrehen wie ein Kessenflicker, der einen Druckkesselflansch anschraubt. Ich habe diesen Fehler anfangs gemacht, und der Erfolg war, dass das Papier sich nicht vom Holz lösen wollte. Dieser Effekt, dass die Gelatine am Holz klebt, ist mir, obwohl ich ihn bei unbearbeitetem Holz erwartet hatte, nur in diesem Fall untergekommen, sonst aber nie. Heute drehe ich die Flügelmuttern (Den Luxus habe ich mir geleistet.) mit der Hand zu, während ich die Schraubenköpfe mit dem Daumen andrücke. Reicht!
Noch eines: Ich fand es anfänglich ganz fürchterlich, so viele Schrauben drehen zu müssen – bis ich darauf kam, dass man je nach Format durchaus auf zwei bis drei Seiten die Flügelmuttern auf den Schrauben lassen kann und die Bilder bequem daruntermogeln kann.
Auch hier: Nachteile?
Auch diese Methode hat ihre Nachteile:
- kostet so ein Haufen Schrauben und insbesondere Flügelmuttern etwas, und
- kann es die Geduld schon etwas strapazieren, so viele Schrauben anzudrehen.
Alternative Konstruktion
Ich hatte einmal mit dem Gedanken gespielt, die Sache auf einen festen Rahmen mit aufschraubbaren Profilen zu reduzieren. Damit wären die Fotos, da allseitig belüftet, sicher schneller getrocknet. Das Ganze hat jedoch einen gravierenden Nachteil: Versuchen Sie einmal, ein nasses Bild freischwebend in einen Rahmen einzuspannen. Geht nicht! Es hängt durch. Von einem Experten, dem das Einspannen offenbar trotzdem (vermutlich mit untergelegtem Brett) gelungen ist, hörte ich dann später, dass ihm ein solcher Rahmen beim Trocknen eines 40x50-Prints unter der Spannung des trocknenden Papiers zusammengebrochen sei. Das Brett hat also schon seinen Sinn.
Neben einer Reihe von Glückwünschen nach Teil 1 dieses Artikels, für die ich Ihnen recht herzlich danke, gab es auch die eine oder andere fachliche Zuschrift. Einige Anhänger der Klebebandmethode wiesen mich darauf hin, dass dieses oder jenes Problem bei ihnen auch, aber eben nur vorübergehend aufgetreten sei, und dies oder jenes sei die Lösung gewesen. Frau Hermanutz schrieb mir, dass Sie für die Klebebandmethode ganz begeistert von der Resopalplatte Trespa Meteon von Hoechst sei. Das Material ist zwar sehr teuer, aber Verschnittstücke sind wohl im Baumarkt für’n Appel und ’n Ei zu bekommen.
Daher eine Erläuterung: Ich will niemanden bekehren; man kann sich auf die Klebebandmethode einschießen – gar kein Zweifel. Ich war nur immer schon unzufrieden mit den Idiosynkrasien dieser Methode. Ich habe beim Ausprobieren meiner Methode nur wenig weniger Ausfälle gehabt als mit der Klebebandmethode.
So, das war sie, meine Revolution im Trockenwesen. Vielleicht finden Sie das Ganze nicht so spannend, dass Sie so lange darauf gewartet hätten. Dann nehmen Sie bitte zu meiner Entschuldigung zur Kenntnis, dass es ja auch nur für einen Artikel gedacht war.
Für mich waren die letzten zwei Monate, die ersten im Leben meiner jüngsten Tochter, extrem spannend.
Viel Spaß beim Basteln und Fotografieren.
Ihr Kolumnist Thomas Wollstein
Eine spannende Angelegenheit - Trocknen von Barytprints (ein halber Artikel)
Thomas Wollstein
Juli/August 2004
Wozu eigentlich noch Baryt?
Hinter Glas ist ein Barytprint nachweislich nicht von einem PE-Print zu unterscheiden. Bisher hat mir jedenfalls noch niemand das Gegenteil beweisen können. Dennoch gibt es noch Barytprints? Warum eigentlich? PE-Papier ist leichter zu verarbeiten, trocknet schneller und immer glatt, und es gibt auch extra dickes PE-Papier, damit man „richtig was in der Hand“ hat, ganz wie bei Baryt. Ob die Haltbarkeit hinreichende Rechtfertigung für den zusätzlichen Aufwand für Barytprints liefert, darüber streiten die Experten. Man kann argumentieren, dass Barytprints zumindest gezeigt haben, dass sie 100 Jahre halten können, während noch niemand einen 100 Jahre alten PE-Print gesehen hat. Dieses Argument ist nicht anzufechten. Es ist wie bei vielen anderen Dingen im Leben: Letztendlich entscheidet der Glaube.
Sie dürfen mich nach dieser Vorrede natürlich fragen, ob ich selbst auf Baryt printe, und ich gestehe freimütig, dass ich – teils auf Grund des zuletzt genannten Arguments, teils aus Nostalgie, teils aber auch, weil ich bestimmte Dinge bisher nur mit bestimmten Barytpapieren erreicht habe – auch immer wieder auf Barytpapier vergrößere, bei Fotos, an deren Haltbarkeit mir wirklich viel liegt, eigentlich ausschließlich.
Vielleicht ist das Vergrößern auf Baryt auch so etwas wie die von Zeit zu Zeit aufkommenden Gegenbewegungen zum immer schnelllebigeren Mainstream, wie Slow Food und ähnliches. Baryt hat eine gewisse Ursprünglichkeit, die einen die Idiosynkrasien und Mühen der Verarbeitung mit fast masochistischer Genugtuung genießen lässt.
Das Problem
Doch nach dieser Abschweifung ins Weltanschauliche zum Thema: Papier – und Barytpapier ist echtes Papier – neigt dazu, auf Befeuchtung und Trocknung mit Wellenbildung zu reagieren. Fotopapier ist zwar schon ein besonderes Papier, gefertigt, um die mehrfache Behandlung (aus Sicht des Papiers eher Misshandlung) mit Chemikalienlösungen wechselnden pH-Wertes möglichst unbeschadet zu überstehen. Viele Papiere würden das nicht überleben.
Jetzt auch noch zu verlangen, dass das so geschundene Papier ohne weiteres Zutun glatt trocknet, hieße, an Wunder zu glauben.
Um alles noch zu verkomplizieren, ist Fotopapier eine Mehrlagenkonstruktion: Papier unten, Gelatine oben drauf. (Es gibt noch mehr dazwischen, aber das sind die wesentlichsten Bestandteile in diesem Zusammenhang.) Beides saugt sich im Zuge der Verarbeitung mit Wasser und Chemie voll und dehnt sich dabei nicht unerheblich aus, und beides zieht sich beim Trocknen wieder zusammen – aber nicht etwa wieder auf die Originalmaße! Und es ist auch naiv, zu glauben, dass Gelatine und Papier, wenn sie sich durch Quellung ausdehnen, beim Trocknen ganz einfach wieder auf ihre alten Maße zurückschrumpfen. Wäre das so, hätten wir kein Planlageproblem.
Die Erfahrung zeigt, dass die weitaus meisten Papiere nach dem Trocknen nicht mehr glatt liegen. Ein paar Papiere lassen sich relativ leicht plätten, indem man sie für ein paar Tage bis Wochen zwischen die Seiten eines schweren Buchs legt. Es gibt aber auch Papiere – sie sind nicht einmal selten – die sich bei „freier“ Lufttrocknung so ekelhaft verziehen, dass man sie nicht einmal zwischen Buchseiten legen kann, ohne Falten zu erzeugen – und damit das Bild unbrauchbar zu machen.
Dieser krasse Effekt zeigt ganz klar auf, wo das Problem liegt: Die Schrumpfung des Papiers beim Trocknen geschieht nicht gleichmäßig, sondern ortsabhängig. In Prosa: Der Rand des Blatts zieht sich stärker zusammen als die Mitte. Dann hat die Mitte nicht genügend Platz und tut das einzig Mögliche: Sie weicht in die dritte Dimension aus; die Kurve zwischen zwei Punkten ist länger als die gerade Linie. Das Papier liegt nicht mehr glatt, sondern ist gewellt.
Was kann man dagegen tun?
Über die Jahrhunderte wurden viele Lösungen vorgeschlagen:
Trocknung auf der Presse löst das Problem, indem dem Papier durch ein darüber gespanntes Tuch die Möglichkeit genommen wird, auszubüxen. Es muss zwangsweise relativ plan trocknen. Wie jedes Verfahren, so hat auch dieses Vor- und Nachteile:
Pro:
- Verlässlich
- Schnell
- Geringer Platzbedarf
Contra:
- Die Presse kostet Geld.
- Sie verbraucht Energie.
- Heißtrocknung kann, besonders bei Tonung, zu Tonänderungen führen.
- Das Tuch bedeutet eine gewisse Gefahr der Verschleppung von Kontamination.
Trocknung auf Rosten, Rahmen, die mit Fliegengitter bespannt sind, soll das Problem, wenn nicht lösen, so doch lindern, indem man die Bilder mit der Emulsionsseite nach unten auf die Roste legt, um zumindest die eigene Schwerkraft der Biegungstendenz entgegenzustemmen. Man sorgt zudem für eine möglichst langsame und gleichmäßige Trocknung, indem man nicht zu warm und unter nicht zu starkem Luftwechsel trocknet.
Bei gutwilligen Papieren reicht eine Kombination dieses Verfahrens mit nachfolgendem Pressen in Büchern aus, um recht glatt liegende Bilder zu bekommen.
Pro:
- Geringe Investition
- Kein Energieverbrauch
- Die Gitter lassen sich leicht reinigen.
Contra:
- Funktioniert nicht bei allen Papieren.
- Braucht vergleichsweise viel Platz.
Trocknen auf der Leine, aufgehängt an einer Wäscheklammer, ist der sicherste Weg, fürchterlich verbogene Prints zu bekommen. Dadurch, dass die Prints während des Trocknens einem, wenn auch geringen, diagonalen Zug ausgesetzt sind, ist es recht sicher, dass die eine Diagonale nach dem Trocknen länger ist als die andere, und der oben beschriebene Effekt (Ausweichen in die dritte Dimension) tritt verschärft ein.
Pro:
- Keine wesentliche Investition
- Keine wesentlichen laufenden Kosten
- Keine aufwendigen Geräte
Contra:
- Absolut kontraproduktiv
Schon etwas weniger desaströs wird der Trocknungserfolg, wenn man das Bild an zwei Klammern aufhängt. In manchen Büchern wird empfohlen, die Trocknung zu verlangsamen, indem man je zwei Blätter Rücken an Rücken aufhängt. Angeblich sollen die beiden einander auch, wenn sie an allen vier Ecken durch Wäscheklammern verbunden sind, durch ihre entgegengesetzten Krümmungsneigungen gegenseitig etwas glatter ziehen.
Hat das jemals bei jemandem geklappt? Bei mir nicht. Bei mir war der Erfolg dieser Methode der, dass durch den Kampf der Bilder eher chaotische Zugverhältnisse auftraten, die eher zu schlechterer als zu besserer Planlage nach dem Trocknen führten.
Aber man sieht, wo der Hase im Pfeffer liegt: Es ist erforderlich, das Blatt während des Trocknens einem gleichmäßigen Zug auszusetzen. Ein Verfahren, das m.W. keineswegs seine Ursprünge in der Fotografie hat, sondern bei den Aquarellmalern (Deren Probleme sind ähnlicher Natur.), ist die Klebebandmethode. Das Verfahren besteht darin, das nasse Blatt mit Nassklebeband aus Kraft-Papier schön plan auf eine Platte zu kleben und so trocknen zu lassen. Nach dem Trocknen schneidet man das Klebeband ab, und das Bild liegt so platt, wie es nur liegen kann.
Es empfiehlt sich aus meiner Sicht, eine chemisch neutrale Platte zu verwenden. Faserplatten, deren Leim sich auflösen kann, sind aus meiner Sicht nicht sinnvoll, da keiner weiß, was der Leim im Laufe der Jahre mit den Bildern macht. Spanplattenhersteller achten ja vielleicht noch darauf, dass die Platten kein Formaldehyd abgeben, aber bestimmt nicht darauf, dass die Platten zum Bildertrocknen geeignet sind.
Wichtig ist es auch, dass die Platten schön sauber sind, d.h. dass keine Holzspäne oder ähnliches darauf liegen. Wenn das Papier nämlich unter erheblicher Zugspannung wie eine Prinzessin auf der Erbse mit einem Krümel drunter getrocknet ist, hat es hinterher eine Beule, die nicht mehr zu reparieren ist.
Das ideale Verfahren? Nicht ganz. Es treten immer mal wieder Probleme auf:
Manchmal war der Print oder das Klebeband zu nass oder zu trocken und haftete nicht richtig. Dann rutschte das Blatt stückweise unter dem Klebeband heraus oder das Klebeband löste sich vom Brett. Das aber bedeutete, dass die Zugspannung nicht mehr gleichmäßig war und das Papier sich übel verzog (siehe Bild), mitunter irreparabel. Manchmal konnte man aber den Schaden reparieren, indem man das Blatt noch einmal einweichte und erneut trocknete. Das ging aber nur in begrenztem Rahmen, und ob es dem Papier gut tat, wage ich zu bezweifeln.

Das hier dargestellte Bild ließ sich übrigens wie oben beschrieben retten.
Stellt man die Bretter mit den aufgeklebten Papieren vertikal auf (z.B. aus Platzgründen), so kam es bei zu nassem Klebeband dazu, dass der weiche Klebeglibber am Bild herunterlief. Solche Bilder sind nur noch zur Auskleidung des Papierkorbs geeignet.
Es gibt das Klebeband in zwei Varianten, nämlich braun und weiß. Das braune besteht aus so genanntem Kraft-Papier und sieht sehr nach Umzugskarton aus, das weiße wirkt etwas sauberer und edler. Aber das täuscht. Keines der Klebebänder ist säurefrei bzw. archivtauglich. Und das weiße ist nach meiner Erfahrung Bockmist! Wo das braune versagte, weil es nicht richtig klebte, klebte das weiße prima, hielt aber der Zugspannung nicht Stand und riss. Das kam bei dem braunen auch ab und an vor, aber bei dem weißen bei mir fast ständig. Die Spannung hängt sicher von der Bildgröße ab, so dass das weiße Klebeband bei kleinen Formaten noch funktionieren kann, aber ab 24x30 cm bin ich damit nicht mehr glücklich geworden.
Mein Rat also: Wenn Klebebandmethode, dann mit dem braunen Klebeband (z.B. von PHOTOTEC). Lassen Sie um Ihr Bild einen genügend breiten Rand, mindestens 1 cm allseitig, und sorgen Sie dafür, dass das Klebeband parallel zur Kante klebt, d.h. dass es zumindest nicht allzu schief aufgeklebt ist. Schiefes Kleben führt zu ungleichmäßiger Spannung, die zwar hier nicht zu einer Wellung des trockenen Bildes führt, aber trotzdem dazu, dass es sich leicht verzieht. Wäre doch echt ärgerlich, wenn Sie stürzende Linien bei der Aufnahme durch ein teures Shift-Objektiv oder aufwendige Kameraverstellung vermeiden oder unter dem Vergrößerer umständlich nach Scheimpflug entzerren, um das Bild nachher zu verzerren.
Schnitt!
Eigentlich sollte es hier weitergehen, und ich wollte Ihnen mein verschnitt- und klebebandfreies Trockenverfahren reich bebildert darstellen, aber dann
 und schließlich
und schließlich

Oder in Worten: Meine zweite Tochter zog es vor, ihren Entbindungstermin etwas vor den ausgerechneten Termin zu verlegen, und eine Menge für die noch verbleibenden 14 Tage geplanten Aktivitäten, darunter auch die Vollendung dieses Artikels, blieb keine Zeit mehr. So bleibt es denn diesen Monat bei dem, was Sie bis jetzt schon gelesen haben. In meiner nächsten Kolumne kommt dann die Revolution in der Baryttrocknung. Ich bitte um Verständnis und Geduld.
Ihr Kolumnist
Thomas Wollstein
Was heißt eigentlich „besser“?
Und für wen?
Ver(schlimm)besserungen an guten Filmen
Thomas Wollstein
Juni 2004
Unlängst bei uns daheim im Badezimmer schallte es aus der Dusche: „Das ist vielleicht ein Mist! Das Zeug bringt ja überhaupt nichts mehr!“
Ausgestoßen hatte diesen Ruf meine Tochter, 10 Jahre, die gerade dabei war, nach der regelmäßigen Haarwäsche die Spülung anzuwenden, die notwendig ist, damit man ihre langen Haare gut auskämmen kann. Und Grund des Fluchs war die Tatsache, dass die Spülung, eine frische Flasche, die erstmals der Aufdruck „Neu“ zierte, nicht mehr brachte, was sie bisher üblicherweise leistete.
Was das in dieser Kolumne zu suchen hat, fragen Sie? Nun, das ist einfach erklärt: Vor ungefähr zwei Jahrzehnten wurden die T-max- und Delta-Filme eingeführt, die Dank innovativer Kristallstruktur (Flachkristalle) bei gleicher Empfindlichkeit ein viel feineres Korn hatten als die bis dahin verfügbaren Emulsionen mit klassischen, kubischen Kristallen. Man konnte damals pauschaliert sagen, dass ein alt hergebrachter 100er (kubisch) im Korn einem neuen 400er (Flachkristall) entsprach.
Ein paar Jahre ist es jetzt her, dass Ilford den Delta 400 „Neu“ auf den Markt brachte, der – so Ilford – in wesentlichen Charakterzügen „verbessert“ worden war. Genannt wurde insbesondere die bessere Pushbarkeit.
Ich nenne die „Verbesserung“ eigentlich lieber Überarbeitung, denn ich habe danach hauptsächlich drei Dinge bemerkt:
- Meine bisherigen, eingetesteten Entwicklungszeiten stimmten nicht mehr.
OK, für eine Verbesserung der Filmeigenschaften würde man das schlucken. Man bekäme ja etwas für den nötigen Aufwand. - Das Filmkorn war grober, nicht etwa feiner.
Ich habe mit dem alten Delta 400 aufgenommene Fotos, die ich in ganz hervorragender Qualität auf 50 x 75 cm vergrößert habe. Gleiche Vergrößerungen vom neuen Delta 400 sehen im Vergleich damit alt aus.
Aus meiner Sicht ist das eine klare Verschlechterung. - Der (inzwischen nicht mehr ganz) neue Delta 400 braucht noch längere Fixierzeiten.
Flachkristallfilme enthalten Jodide, die die Fixage erschweren. Dadurch brauchen sie sowieso lange zum Fixieren, aber der neue Delta 400 brauchte noch länger als der alte. Das zeigt mir der Klärzeit-Test, den ich vor jeder Fixage mache. Delta 400 ist von allen Filmen, die ich regelmäßig verwende, der, welcher sich am schlechtesten fixieren lässt.
Auch das ist aus meiner Sicht eine klare Verschlechterung.
Wo liegt also für mich der Gewinn? Ich konnte (und kann) keinen finden.
Unlängst fühlte ich mich dann bei einer Tasse Espresso bei einem guten Bekannten mit 50 Jahren Fotopraxis an das Erlebnis mit der Dusche erinnert: Er hatte gerade eine Serie von Fotos vollendet und meinte, irgendetwas müsse ihm da bei der Entwicklung der Filme – alles T-max 400, die er seit Jahren zusammen mit Microdol-X als Standard verwendet – schief gelaufen sein, denn die seien alle viel grobkörniger als früher. Als selbstkritischer Mensch suchte er den Fehler zuerst bei sich selbst, aber bei mir klingelte etwas. Ich hatte doch ein paar Monate zuvor einen Artikel in Photo Techniques USA (Photo Techniques USA, März/April 2003, Seite 18ff.) gelesen, in dem zwei Ex-Kodak-Forscher, nun im Ruhestand, über Tests von neuen, „überarbeiteten“ Kodak-Filme berichteten. Dabei war neben Klassikern wie Tri-X auch der T-max 400.
Die Überarbeitung geschah mit einer doppelten Begründung:
- Man hat sich auf nur noch eine große Produktionsstätte konzentriert.
- Bestimmte Filmeigenschaften (z.B. Scanbarkeit) seien verbessert worden.
Einen Klassiker wie den Tri-X, den m.W. weltweit am meisten verkauften 400er SW-Film mit vielen treuen Fans, zu „überarbeiten“ erscheint schon fast als ein Sakrileg, aber das sei einmal dahingestellt. Bei diesem Film scheint sich jedoch tatsächlich etwas im üblichen Sinne des Worte verbessert zu haben: Dick Dickerson und Silvia Zawadzki, so die Namen der beiden genannten Kodak-Forscher, haben die neuen Filme getestet und festgestellt, dass der neue Tri-X, jetzt 400 TX genannt, im Vergleich mit dem alten feinkörniger geworden ist. (Witzigerweise ist inzwischen tatsächlich der klassische Tri-X feinkörniger als der „moderne“ T-max 400. Wenn Sie’s mir nicht glauben wollen, lesen Sie’s nach oder – besser noch – testen Sie’s selbst.)
Kodak hat auf die Änderung deutlich hingewiesen und gewarnt, dass die Entwicklungszeiten möglicherweise angepasst werden müssten. Man konnte also erwarten, dass sich wirklich etwas an den Emulsionen getan hätte. Lt. Dickerson/Zawadzki und anderen Quellen (u.a. die französische Réponses Photo) ist das in der Tat aber nicht der Fall. Bleiben Sie also ruhig bei den alten Zeiten, solange Sie keinen Grund haben, sie anzuzweifeln. Also doch alles beim Alten?
Nicht wirklich: Alle getesteten „verbesserten“ Kodak-Filme außer Tri-X, d.h. T-max 100, T-max 400, T-max 3200 und Plus-X, sind lt. zitiertem Artikel in Photo Techniques nach subjektiver Beurteilung des Korns grobkörniger geworden!
Jetzt frage ich Sie, liebe Leser: „Was heißt eigentlich ‚besser’? Und für wen?“
Besser für Kodak mag es sein, dass man nur noch eine große Fabrik hat, in der alles läuft. Schließlich heißt das, dass man weniger Angestellte bezahlen muss, und heute trennt sich jeder Arbeitgeber von der größtmöglichen Anzahl seiner Arbeitnehmer, um den Profit für Management und Aktionäre zu vergrößern.
Halten wir aber die Politik weitgehend aus dieser Kolumne und reden wir nicht darüber, dass ich es nicht als Verbesserung sehe, wenn ein paar Firmenstandorte mehr geschlossen werden und wieder mehr Leute arbeitslos auf der Straße stehen.
Der Fairness halber sollte man auch darauf hinweisen, dass ein großes Volumen aus einer Produktionsstätte sicher auch Vorteile im Hinblick auf die Produktionsstreuung hat.
Für mich sind aber mit den Überarbeitungen eine Reihe von Filmen in fototechnischer Hinsicht eindeutig schlechter geworden:
- Grobkörniger ist für mich schlechter!
- (Noch) Länger zu fixieren ist für mich schlechter!
- Neu kalibrieren zu müssen, ohne etwas dafür zu bekommen, ist für mich schlechter!
Gerade vor ein paar Tagen erreichte mich eine Mail von einem Leser, der mich nach den „definitiven“ Unterschieden zwischen Flachkristall- und kubischen Emulsionen fragte. (Woher wusste er bloß um das Thema dieser Kolumne? Dieser Artikel war da schon fast fertig.) Ich denke, eine "definitive" Antwort auf diese Frage kann man nicht geben, denn auch bei den Flachkristall-Emulsionen gibt es nach jetzt schon gut 20 Jahren Markterfahrung, während der die Zeit nicht stehen geblieben ist, eine interessante Vielfalt. Auch bin ich überzeugt, dass die oben erwähnte größere Revision nur die Spitze eines Eisbergs ist. Es ist bei Fotofirmen Gang und Gäbe, dass bei bewährten Produkten nur der Name unverändert bleibt. In Controls in Black-and-White Photography beschreibt Richard Henry, wie er sich als Forscher gefühlt hat, als er erfolglos versucht hatte, die Ergebnisse eines Kollegen zu verifizieren und daraufhin an der Methodik des Kollegen zweifelte – und dann erfuhr, dass der Standard-Entwickler, den der Kollege und er für die Versuchsreihen verwendet hatten, möglicherweise zwischen den beiden Messreihen von Kodak ohne Hinweis an die Nutzer leicht „verbessert“ worden war.
Wir sind also als Fotografen oft zu zahm gegenüber unseren Herstellern. Wie der eingangs erwähnte Kollege suchen wir – was auch sicher nicht falsch ist – den Fehler immer erst bei uns, wenn etwas nicht mehr klappt. Aber wir sollten ihn nicht ausschließlich bei uns suchen. Nachfrage beim Hersteller weckt auch bei diesem vielleicht etwas mehr Bewusstsein. Fotografie und EDV wachsen enger zusammen, aber das heißt nicht, dass wir dieselben Zustände (oder besser: Missstände) anstreben sollten. Bill Gates hat aus Software Bananaware gemacht. (Sie kennen den Kalauer: reift beim Kunden.) Wir sollten den Fotoprodukte-Herstellern nicht dasselbe erlauben.
Doch nach dieser Klage zurück zur Vielfalt der Emulsionen: Da sind inzwischen Flachkristallfilme, die extrem feinkörnig sind, und deren Empfindlichkeit in verschiedenen Entwicklern sehr stabil ist, und andere, die deutlich flexibler reagieren, dafür aber groberes Korn aufweisen.
Zwischen dem altem Ilford Delta 400 (lange mein Vorzugsfilm) und neuem sind die Unterschiede deutlich: Auf Kosten des Korns ist der Film deutlich flexibler geworden. Das meint wohl Ilford mit der verbesserten Pushbarkeit. Er soll auch hinsichtlich der Lichterwiedergabe verbessert worden sein, etwas, das ich so nicht empfunden habe, denn ich hatte mich auf den alten so eingearbeitet, dass er für mich tat, was ich wollte. Ich habe bei Freunden Bilder hängen, z.B. eine Gegenlichtaufnahme vom Markusplatz in Venedig, aufgenommen in die Sonne hinein, mit vielen tiefen Schatten und Silhouetten, bei denen ich saubere Schattenzeichnung, gestochene Schärfe und feine Lichterzeichnung bei annehmbarem Korn habe. Von diesem Negativ habe Vergrößerungen bis 50 x 75 cm in einer Qualität angefertigt, die mir der neue Delta 400 nicht mehr bringt.

Markusplatz Venedig an einem Januarvormittag, alter Ilford Delta 400, unmanipulierter Scan

Gleiches Negativ: Lichterdetail, unmanipulierter Scan
Gleiches Negativ: Schattendetail, unmanipulierter Scan
Nachdem sich daher die Unterschiede zwischen den Emulsionstypen langsam zu verwischen scheinen, kann man nicht mehr wie früher pauschalieren und behaupten, heute habe ein 400er Flachkristallfilm dasselbe Korn wie ein kubischer 100er. Es bleiben aus meiner Sicht besonders die schlechten Seiten übrig, insbesondere die unangenehm lange Fixage auf Grund des Jodidgehalts der Flachkristalle. Beim T-max 400 scheint sich eine ähnliche Entwicklung ergeben zu haben.
Im Film Developing Cookbook schrieben Anchell und Troop schon vor Jahren sinngemäß, dass sie Flachkristallemulsionen für die schlechteren hielten, die nur dem einen Zweck dienten, Silber einzusparen, damit die Fotoindustrie mit weniger Rohstoffen mehr Marge macht.
Sollten kenntnisreiche Menschen von Kodak oder Ilford oder auch von anderer Seite dieses Klagelied lesen und wissen, wo ich die Verbesserung in dieser Katastrophe finde, so bitte ich dringend um Aufklärung.
Glück gehabt!
Thomas Wollstein
Mai 2004
Auf Englisch hieße die Überschrift „I was lucky!“, und in der Tat muss ich sagen, dass ich Glück gehabt habe. Durch Unerwartetes im privaten Bereich hatte ich viel weniger Zeit als erhofft, um die für diesen Artikel nötigen Tests durchzuführen. Nun hatte ich Ihnen aber versprochen, Ihnen diesen Monat einen Bericht über neue, sehr preisgünstige SW-Filme zu bieten.
Glück im Unglück: Ich hatte schon im Vorfeld zwei vielen meiner Leser bekannte Experten, Herrn Borgerding und Herrn Jangowski, gefragt, ob Sie interessiert wären, die Filme auch zu testen. Bekanntlich hat jeder andere Ansprüche, und so ist es sicher nicht schlecht, wenn nicht nur einer testet. Dass in diesem Fall dieser Artikel nur deswegen erscheinen kann, weil die Beiden sich der Aufgabe, die Filme auf Herz und Nieren zu testen, in verdienstvollster Weise angenommen haben, obwohl auch Sie bestimmt nicht unterbeschäftigt sind, dafür möchte ich auf diesem Wege Herrn Borgerding und Herrn Jangowski herzlich danken. Das Inhaltliche dieses Artikels ist daher in der Hauptsache das Verdienst der Beiden, die redaktionelle Aufbereitung und eventuelle Fehler stammen von mir.
Zum Thema:
Billigfilme bisher …
Bislang kamen die meisten Filme „im unteren Preissegment“ („billig“ klingt doch sehr anrüchig.) aus dem Osten, sprich von Forte, Foma und Konsorten. An der Himmelsrichtung ändert sich nichts, nur an der Entfernung: Die Filme, die ich Ihnen vorstellen möchte, kommen aus dem Reich der Mitte, d.h. aus China, und schmücken sich mit dem Namen Lucky (siehe Vorspann).
Lucky gibt’s seit 1956, und seit ein paar Jahren könnte die Firma man witzelnd als „Kodak auf Chinesisch“ übersetzen: Kodak hat m.W. eine nicht unerhebliche Aktienbeteiligung, und die Fabrikausstattung ist nach Informationen aus gut unterrichteten Quellen vor nicht allzu langer Zeit modernisiert worden. Lucky produziert nun unter Kodak-Lizenz Filme und Papiere.
Ich bin durch Kontakte in England auf diese Filme gestoßen und bekam das Angebot, die Filme zu testen und darüber zu schreiben. Wer möchte nicht einmal in seiner Kolumne etwas Brandaktuelles vorstellen, und so sagte ich zu.
… und jetzt
Falls nicht das Schiff mit dem Container untergegangen ist, gibt es bald folgende Lucky Filme in Europa:
- Lucky SHD 100 New 135-36 (ab Ende Mai)
- Lucky SHD 400 New 135-36 (ab Ende Juni)
- Lucky SHD 100 New Professional 120 (ab Ende Juni)
Man beachte den Zusatz New hinter dem Namen: Auf der letzten Photokina hatte Lucky einen Stand in Halle 3, wo Probefilme verteilt wurden. Die damalige Qualität entsprach in etwa dem, was man von den bisherigen Billigfilmen gewohnt ist. Alle drei Filme wurden im Nachgang überarbeitet und erheblich verbessert.
Die Ladenpreisempfehlung für eine 10er-Stange beläuft sich auf 1,95 EUR je Film, eine deutliche Duftmarke im Revier der Billigfilme.
Eine Liste der ersten Bezugsquellen ist am Ende des Artikels angegeben.
Technisches
Sparsamkeit hat ihren Preis, und so kommen die Filme mit nur wenigen technischen Informationen daher. Als sie uns vorlagen, gab es im Wesentlichen den üblichen Aufdruck auf der Packungsinnenseite, und der war in – Chinesisch – abgefasst. Dazu gab es einen kleinen Werbezettel in miserabelstem Englisch. Man konnte aber erkennen, dass als Entwickler für die Filme Kodak D-76 empfohlen wurde, ein Mixtur, die man vermutlich überall auf der Welt bekommt. Gleichwertig ist übrigens Ilford ID-11 zu verwenden.
Das war’s.
Mit dieser Information gingen die Tester an den Start.
Was fiel auf?
Äußerlichkeiten
Die Verpackungen der Probefilme, die Herrn Borgerding, Herrn Jangowski und mir vorlagen, waren komplett in Chinesisch beschriftet. Für den europäischen Markt werden die Filme aber künftig in englisch beschrifteten Schachteln stecken, und es wird zumindest eine englische Information dazu geben. Sie müssen also nach dem Kauf der Filme nicht erst chinesisch essen gehen und den Ober um Hilfe bitten. (Gehen Sie aber lieber auch nicht englisch essen!)
Die KB-Filme kommen in unverschweißten Patronen daher. Das werden die Selbst-Einspuler unter den Pfennigfuchsern begrüßen, macht es doch die Weiterverwendung für eigene Meterware einfach. Die Deckelchen lösen sich recht leicht, nach meinem Geschmack fast zu leicht: Ich stelle mir vor, dass so ein Deckel auch einmal abspringen kann, wenn einem der Film hinfällt. (Probiert habe ich das nicht.)
Der Rollfilm kommt in einer robusten Papierverpackung daher, die Herrn Jangowski wegen ihrer knallroten Farbe zu Recht an einen Chinaböller erinnerte. Witzig fand ich es, als ich am Ende des Rollfilms in Deutsch und Englisch den Aufdruck „Hier falten“ bzw. „Fold here“ auf dem Schutzpapier fand, wo doch sonst für westliche Hirne verarbeitbarer Text in der Umgebung der Filme selten war. Wie ich inzwischen gelernt habe, liegt das daran, dass seit Jahrzehnten das Schutzpapier für praktisch alle Rollfilme westlicher Produktion aus Deutschland stammt, und das der Lucky Filme kommt tatsächlich aus derselben deutschen Fabrik.
Der Rollfilm hat keine Randbelichtung, das ist für den einen oder anderen Fotografen ein echter Nachteil. Herr Jangowski und ich haben den Film beide in alten Rolleiflex-Modellen getestet. Dort ist die Dicke der Klebestelle und des Schutzpapiers nicht ganz unkritisch, da die Rolleiflex den Filmanfang durch mechanische Abtastung erkennt. Probleme sind dabei nicht aufgetreten.
Die Filme kommen auf klaren Trägern daher. Diese sind nicht ganz so transparent wie die eines MACO IR 750 oder 820c oder PO 100c, aber in keiner Weise vergleichbar mit den grauen Trägern der meisten anderen Filme.
ANMERKUNG: Klare Träger haben deutliche Vorteile beim Lith-Printing: Die Belichtungszeiten sind dort ohnedies schon unangehm lang. Bei einer Belichtungszeit in der Größenordnung von Minuten bin ich ganz froh, wenn ich eine halbe Blende (rund 20%) einsparen kann, so dass mein Vergrößerer nicht ganz so heiß wird und die Lampe länger lebt.
Entsprechend haben die Lucky Filme vermutlich eine auf der Trägerrückseite liegende, wasserlösliche Lichthofschutzschicht, wie sie z.B. von den MACO-IR-Filmen und meinem Lieblingsfilm MACO PO 100c her bekannt ist.
Beim Rollfilm wurde – auch das war früher üblich, ist aber heute wohl im Sinne einer Vereinfachung der Fertigung bei den meisten Filmen eingespart worden – der Träger so behandelt, dass man auf der Filmrückseite Bleistiftretuschen vornehmen kann.
Mich hat etwas gestört, dass das Klebeband am Ende des Rollfilms nicht restlos ablösbar ist. Ich habe nicht gerne Papierreste auf meinen Filmen kleben. Papier wässert viel langsamer aus als die Emulsion, was zu einer Verschleppung von Fixierbadresten führen kann. Es ist daher sinnvoll, das mit Klebeband verunzierte Filmende abzuschneiden. Mindestens aber sollte man die Filme zum Trocknen mit dem Klebebandrest nach unten aufhängen, damit nicht aus dem Papier Wasser mit höheren Rest-Thiosulfatkonzentrationen den ganzen Film hinunter läuft. Ein Leser, dessen Namen ich mir leider nicht notiert habe, hat mir vor Jahren von Analysen berichtet, die er hat durchführen lassen und die bestätigen, dass dies wirklich zu einer deutlichen Kontamination des Films führt.
Für die 100er Filme reklamiert Lucky besondere Robustheit gegenüber hohen Temperaturen und Luftfeuchtewerten, sprich: so etwas wie Tropenfestigkeit. Die Gelatine ist also vermutlich stärker als gewöhnlich gehärtet, was sie als Nebeneffekt auch mechanisch robuster machen wird.
Die Filmträger trocknen unproblematisch ohne Rollneigung.
Verarbeitung
Die Genossen aus dem fernen Reich der Mitte sind von der schnellen Truppe: Die Emulsionen entwickeln schnell und fixieren im Blitztempo. Für Kodak D-76 (Ilford ID-11 ist gleichwertig.) sind folgende Zeiten angegeben:
|
Lucky SHD 100 New |
5 min |
|
Lucky SHD 400 New |
7 bis 10 min |
Diese Werte gelten für Kippentwicklung bei 20°C.
Detaillierter sind die Ergebnisse von Herrn Jangowskis methodischer Forschung. Für D-76 1+1, 20°C, Rotation, wurden von ihm folgende Kontrastwerte ermittelt:
|
Entwicklungszeit (min) |
SHD400 |
SDH100 |
|
5:00 |
0.39 |
0.53 |
|
7:00 |
0.50 |
0.62 |
|
9:00 |
0.63 |
0.79 |
|
12:00 |
0.68 |
0.83 |
Der 100er Film scheint bei aggressiv arbeitenden Entwicklern relativ empfindlich auf Veränderungen der Entwicklungszeit zu reagieren: Herr Borgerding berichtet, dass es ihm nicht geglückt ist, beim 100er Rollfilm für SPUR HRX bei üblicher Verdünnung brauchbare Zeiten zu ermitteln: Eine Variation von 30 Sekunden in der Entwicklungszeit, d.h. nicht einmal 15%, bedeutet hier einen Sprung von deutlicher Unterentwicklung zu deutlicher Überentwicklung.
Mit dem Allzweckentwickler D-76/ID-11 (einem Feinkorn-Ausgleichsentwickler) sollte man bei sauberer Arbeitsweise aber keine Probleme haben. Wenn man mit anderen Entwicklern experimentieren möchte, sind für den Anfang langsamere, ausgleichende Typen, z.B. Rodinal in höherer Verdünnung (z.B. 1+50), zu empfehlen.
Bei der Fixage geht’s ähnlich flugs, nur stört es da keinen – im Gegenteil. Eine Klärzeitprobe zeigte für den 100er Film in frischem Fixierer eine Klärzeit von unter 15 Sekunden, und auch der 400er ist rasend schnell, unter 30 Sekunden. Unter denselben Bedingungen bekomme ich bei gängigen Filmen (Ilford Delta 400 ausgenommen) Klärzeiten von 30 bzw. 60 Sekunden.
Dies habe ich zunächst so gedeutet, dass die Filme eine an Jodid arme klassische Kristallstruktur haben, denn (wie im Kolumnenbeitrag zur Fixage „Geht’s noch?“ erläutert) Jodid verlangsamt die Fixage in aller Regel sehr.
Tatsächlich müssen die 100er Filme aber wohl trotzdem untypisch hohe Mengen Jodid enthalten. Das jedenfalls geht aus den Analysewerten von Herrn Borgerding hervor, der sein Fixierbad nach der Verarbeitung von ein paar davon analysiert hat.
Die von Herrn Borgerding aufgestellte Vermutung, dass es sich beim Lucky SHD 100 New um eine Flachkristallemulsion handelt, ist daher nicht ganz unplausibel. (Auch die Zickigkeit spricht dafür.) Es könnte sich angesichts der Beteiligung Kodaks um eine Art B-Version der T-max-Emulsionen handeln.
Resultate
Da er es hervorragend zusammenfasst, hier der O-Ton von Herrn Jangowski (Hervorhebungen und Absätze von mir):
„Mein Eindruck der beiden Filme: wirklich gutes Material.
Der 100er ist scharf, hat ordentliche Empfindlichkeit (wie fast alle anderen 100er auch, also für meine Bedürfnisse etwa 64 ASA) und kommt in D-76 gut. Ich würde ihn durchaus als dem APX100 oder FP4+ ebenbürtig ansehen.
Die Gegenlichtaufnahme meines Katers Carlo ist im Spitzlicht leicht überstrahlt, das kann vom Film oder auch von dem doch nicht ganz so gut vergüteten Planar meiner Rolleiflex 3.5F kommen… Auch Zeiss hat in den letzten Jahrzehnten dazugelernt. Da der Film unentwickelt extrem hell ist (im Vergleich zu dem fast schwarzen APX100 oder den Deltas) und auch der Träger erheblich weniger Dichte zeigt,könnte es natürlich auch etwas höhere Empfindlichkeit für Diffusionslichthöfe sein. (…)
Der SHD 400 ist ebenfalls scharf, natürlich nicht ganz so feinkörnig wie ein Delta 400, aber durchaus vergleichbar mit einem HP5+ oder APX400.“
Bildbeispiel: Kater Carlo im Gegenlicht, aufgenommen mit der Rolleiflex, Ausschnitt von 15 x15 cm aus einem Bild 50 x50 cm
Als Bildbeispiel sehen Sie hier nur Kater Carlo, auf den Martin Jangowski Bezug nimmt. Um das Filmkorn in fair und aussagekräftig vergleichbarer Weise anschaulich zu machen, müsste ich Ihnen Bilder zeigen, auf denen ein Feld gleicher Dichte, aufgenommen auf den zu vergleichenden Filmen, entwickelt in demselben Entwickler und im gleichen Maßstab wiedergegeben ist. Das auch noch in höchstmöglicher Auflösung bei gleichem Kontrast für beide Scans. Da ich aber leider nicht so viel Zeit zum Testen hatte, wie erhofft, liegen mir keine geeigneten Aufnahmeserien vor. Ich belasse es daher bei der qualitativen Aussage von Martin Jangowski, die aus meiner Sicht aussagekräftig genug ist.
Die Nennempfindlichkeit wird von beiden Filmen einigermaßen eingehalten (was – so habe ich mir sagen lassen – bei manch anderem Billigfilm speziell in der 400er Klasse nicht der Fall ist). Die 100er ordnen sich als qualitativ gleichwertig zwischen Agfa APX100 und Ilford FP4+ ein, der 400er ist bei gleicher Verarbeitung nach meinem Eindruck geringfügig (vielleicht 1/2 Blende) weniger empfindlich als der APX400, als Ausgleich aber auch ein wenig feinkörniger.
Nicht getestet…
…haben wir die Fertigungskonstanz. Dazu müsste man eine große Zahl von Filmen aus verschiedenen Fertigungslosen unter vergleichbaren Bedingungen testen, und das überschreitet einerseits wegen des nötigen Budgets und Zeitaufwands und andererseits wegen der mit Hausmitteln sowieso nicht zu leistenden Konstanz der Testbedingungen unsere Möglichkeiten. Kameras und Filme aus Ländern des früheren Ostblocks und bestimmte Fotopapiere aus China mussten in diesem Punkt zumindest früher einiges an Kritik einstecken. Dort war das Motto: Wenn Sie gut sind, sind sie wirklich gut, aber es sind eben auch ausgesprochene Montagsexemplare dabei.
Angesichts der offenbar mit Geld des „großen gelben Paten“ (sprich: Kodak) aufgewerteten Fertigungsanlagen und der Tatsache, dass Lucky nun ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System) nach ISO 9001 einsetzt, gehe ich aber davon aus, dass solche Probleme hier nicht auftreten werden. Inzwischen lassen eine Reihe von qualitätsbewussten Unternehmen schlicht wegen der geringeren Lohnkosten in China fertigen.
(Kleine Abschweifung vom Thema: Auch wenn’s nix mit Fotografie zu tun hat, möchte ich mit einem Irrtum im Zusammenhang mit QM-Systemen aufräumen: Die Anwendung eines QM-Systems nach ISO 9000ff ergibt nicht automatisch gute Qualität. Diesen Blödsinn sollte man als Verbraucher nicht glauben. Ziel und Zweck eines QM-Systems ist es allein, eine spezifizierte Qualität innerhalb vorgegebener Toleranzen einzuhalten. Ist die spezifizierte Qualität mies, liefert eine Produktion unter einem QM-System Produkte von gesichert mieser Qualität, und sind die vorgegebenen Toleranzen breit, so schwankt die Produktqualität innerhalb dieser breiten Toleranzen, nur eben nicht noch weiter.)
Und hier die Wertung…
Alle drei Filme lohnen es, sie auszuprobieren. Der günstige Preis lädt zum Herumspielen ein. Leisten Sie sich ein paar dieser billigen, Verzeihung: preiswerten Filme, und zelebrieren Sie damit einmal einen Eintest-Vorgang. Oder Sie besorgen sich ein paar davon und verschießen sie nach Lust und Laune. Bei 2 EUR je Film tut es Ihrem Geldbeutel nicht so weh, und schließlich lernt man Fotografieren nur durch eines richtig: durch viel Fotografieren.
Dass die Qualität nicht schlecht ist, hat sich bei diesem Test gezeigt. „Suboptimale“ Lösungen bei bestimmten Details (Klebeband, stückweise Reaktion auf Entwicklungszeit) muss man bei dem Preis vielleicht einfach hinnehmen. Man kann es auch positiv sehen: Es lehrt einen gleich auch noch sauberes, reproduzierbares Arbeiten.
Und jetzt noch die letzte, nicht ganz unbedeutende Frage:
Wo bekommt man Lucky Filme?
Wie eingangs erwähnt, ist dieser Artikel wirklich brandaktuell und erscheint praktisch zur europäischen Markteinführung. Eine lange Liste von Bezugsquellen kann ich Ihnen daher nicht anbieten, doch bin ich zuversichtlich, dass die Liste innerhalb der nächsten Monate erheblich wachsen wird.
Lucky Film im Internet: www.luckyfilm.com
Wollsteins Fotopapier-FAQ - Teil 2
Thomas Wollstein
April 2004
Hier ist er nun, der zweite Teil des FAQ, an dessen Erarbeitung Sie sich durch Ihre Fragen beteiligt haben. Ich hoffe, die Antworten auf die Fragen in Teil 1 haben Sie zufrieden gestellt.
Auch Teil 2 wird noch nicht alle Fragen beantworten. Er ist bereits so lang geworden, dass ich den Aspekt „Hochglanztrocknung“ zunächst noch ausgespart habe. Das hat neben der Länge des Ihnen hiermit vorliegenden zweiten Teils auch den Grund, dass die Ausführungen zum Hochglanztrocknen für sich schon recht umfangreich wären. Es kommt hinzu, dass ich mit dieser Technik selbst kaum Erfahrung habe, da ich nun einmal luftgetrockneten „Naturglanz“ oder sogar mattes Papier (je nach Motiv) bevorzuge. Ich merke das Thema aber vor für eine spätere Kolumne, die sich dann eben mehr auf Literaturrecherche abstützen wird. Frei nach dem Motto: „Ich weiß vieles nicht, aber ich weiß, wo es gut beschrieben steht.“
Um Sie ein wenig anzufüttern, sei hier ein kurzer Ausblick auf die nächsten Monate gegeben: Ich plane für Mai die Vorstellung von neu (eben im Mai, wenn ich dem Anbieter trauen darf) auf den europäischen Markt kommenden, sehr günstigen Filmen. Ich bin froh darüber, dass mir Franz Borgerding und Martin Jangowski ihre Unterstützung dabei zugesagt haben. Mit zwei so sachkundigen Mit-Kritikern wird, so denke ich, eine ausgewogene Meinung herauskommen.
Weitere Beiträge (wobei die Reihenfolge noch nicht sicher ist) plane ich zu den Themen „Vergrößerungsrahmen“, „neutrales Fixierbad“ und „Lufttrocknung von Baryt ohne Klebeband (und trotzdem plan)“.
Jetzt aber weiter mit dem FAQ!
Welches ist die optimale Trocknung für Barytpapier (Luft, Fließpapier, Trockenpresse)?
Stichworte:
• Trockenverfahren (physikalisch, chemisch)
• Geschmack
• Planlage
• Bildton
• Haltbarkeit
• Zeit
Diese Frage geht ein bisschen in die Richtung von „Was ist Ihr Leibgericht?“ Meine Tochter wird Ihnen gleich ein bekanntes italienisches Nudelgericht empfehlen, ich möglicherweise auch, wenn auch ein anderes, und meine Frau ein drittes. Antwort folglich: Das hängt (u.a.) davon ab, was Ihnen gefällt.
Unbefriedigende Antwort? Stimmt! Nähern wir uns der Frage mal von verschiedenen Standpunkten.
Ein Punkt ist sicher der Geschmack. Nicht jeder mag den Spiegelglanz von hochglanzgetrockneten Bildern. Ich mag z.B. (s.o.) luftgetrockneten „Natur“glanz lieber. Geschmack steht außerhalb jeder Diskussion.
Weiterer „geschmäcklerischer“ Aspekt ist der Bildton. Heißtrocknung kann den Bildton, insbesondere bei getonten Bildern, erheblich verändern. Bilder die heiß getrocknet und erst dann getont werden, reagieren - so schreibt es Tim Rudman in seinem „Master Printing Course“ - mitunter deutlich anders auf den Toner als solche, die nur bei Raumtemperatur luftgetrocknet werden. Auch da kommt es also drauf an, ob Sie das Ergebnis mögen oder nicht.
Im Hinblick auf Haltbarkeit ist aus meiner Sicht Lufttrocknung ohne Presse die beste Lösung. Warum? Wenn Sie sich das Tuch Ihrer Trockenpresse einmal mit einem nicht sauber verarbeiteten Bild kontaminiert haben, ist es schwer oder gar nicht wieder sauber zu bekommen. Da hilft auch heißes Waschen m.E. kaum. Denn Thiosulfat wandelt sich im Verlauf von einigen Stunden unter Lufteinfluss in eine unlösliche Verbindung um. Sie alle haben das sicher schon einmal an Fixierbadschalen gesehen: Die Flecken, die in diesen Schalen entstehen, wenn man sie nicht richtig ausspült, sind nur mechanisch wieder zu entfernen, aber auch noch so langes Spülen entfernt sie nicht. Als Randnotiz: Genau aus diesem Grund kann man auch Fotopapiere nicht heute halb wässern und morgen den Rest auswaschen. Der „Rest“ ist nämlich morgen absolut unlöslich. Eine glatte Platte kann man aber, sollte man tatsächlich so geschludert haben, dass sie kontaminiert ist, mit Scheuermilch und Armschmalz (s. Prof. McGonagall in J.K. Rowling, Harry Potter und die Kammer des Schreckens) wieder sauber bekommen.
Aspekt Zeit: Ungeheizte Lufttrocknung braucht etwas Zeit. Wenn Sie auf schnelle Verarbeitung angewiesen sind, ist eine daher Trockenpresse unumgänglich. Andererseits: Baryt und schnell, das sind m.E. zwei Begriffe, die nicht sofort zusammenpassen.
Es gibt natürlich auch noch chemische Schnelltrocknungsverfahren, die darauf beruhen, dass dem Bild das Wasser durch eine geeignete Chemikalie, z.B. bestimmte Alkohole, entzogen wird bzw. das Wasser im Bild durch Alkohol ersetzt wird. Der Wasserersatz verdunstet schneller als Wasser, und so ist das Bild schneller trocken. Das kann man mal als Notbehelf machen, aber als Routineverfahren lohnt es m.E. nicht, denn
• es kostet einiges an Lösemittel,
• Sie brauchen einen sehr gut belüfteten Ort, um das ganze verdunstete Lösemittel abzuführen (und die Mischung aus Alkoholdampf und Luft ist im besten Fall – Ethanol – benebelnd, im schlechtesten schlicht ungesund, kann aber durchaus auch zündfähig sein),
• es ist nicht gerade umweltfreundlich, und
• kann je nach Behandlung Spätfolgen haben.
Schließlich: Aspekt Planlage. Barytbilder, die Sie, wie es früher oft vorgeschlagen wurde und als Klischee immer wieder dargestellt wird, an einer Ecke aufgehängt auf der Leine getrocknet wurden, sind oft nicht mehr vernünftig glatt zu kriegen. Heiß trockengepresste Bilder liegen halbwegs plan. Aber auch luftgetrocknete Bilder kann man absolut plan bekommen, indem man sie aufspannt. Nutzen Sie dazu das Verfahren mit Klebeband, wie es auf der PHOTOTEC-Webseite beschrieben ist, aber besser nicht mit einer unbeschichteten Spanplatte, sondern mit einer resopal-beschichteten Platte als Basis.
Schöner noch geht es mit einer klebebandfreien Barytrockenvorrichtung, deren Selbstbau ich Ihnen in einem der nächsten Artikel vorstellen werde.
Ein anderes Verfahren beruht darauf, die Bilder in nicht mehr nassem, sondern vorgetrockneten, aber noch deutlich feuchtem Zustand zwischen Lagen von Fliespapier zu pressen, bis sie trocken sind und plan liegen. Ich habe dieses Verfahren vor Jahren ausprobiert, habe es jedoch wieder aufgegeben, weil gar zu oft Fusseln auf der Papieroberfläche kleben blieben.
Manche Papiere, besonders z.B. das sehr dicke Fortezo, sind sehr gutmütig. Man lässt sie einfach mit der Bildseite auf einem geeigneten Tuch liegend trocknen und presst sie in trockenem Zustand für ein paar Tage in Büchern oder zwischen Flieslagen, und schon liegen sie absolut glatt.
Nach meinen Erfahrungen hat man mit dickerem Papier in aller Regel weniger Probleme mit der Planlage.
Was ist bei der Trocknung zu beachten?
Stichworte:
• Trocknung PE/Baryt
• Heiß-/Kalttrocknung
• Blooming
• Geschmack
• Glanz
• Zeit
• Verziehen
Die Trocknung von PE-Papier ist denkbar einfach: Hängen Sie die Bilder auf die Wäscheleine oder stellen Sie sie in ein Abtropfgestell für Teller o.ä. Nach ein paar Stunden sind sie absolut trocken. Ein Netzmittel kann helfen, ungleichmäßiges Trocknen mit Fleckenbildung zu vermeiden, aber auch bei dem in Düsseldorf nicht eben kalkarmen Wasser hatte ich ein solches bei Papierbildern noch nicht nötig. Nur legen sollten Sie die Bilder nicht, denn dann läuft das Oberflächenwasser nicht ab, sondern es bilden sich zwangsläufig – auch mit Netzmittel – kleine Seen, die langsam eintrocknen. Dadurch entstehen auch bei nicht sehr hartem Wasser Kalkflecken. Zum Thema „Netzmittel“ siehe aber auch Stichwort „Konservierung“.
Viele glänzende PE-Papiere bekommen durch Heißtrocknung einen schöneren Hochglanz (siehe auch Stichwort „Blooming“). Kommen Sie aber nie auf den Gedanken, PE-Papier auf einer Presse für Baryt zu trocknen. Im schlimmsten Fall können Sie danach die Presse - und natürlich auch das Bild - wegschmeißen. Man kann PE-Papier mit einem Haartrockner trocknen, aber häufig führt das dazu, dass Staubpartikel auf die warm doch recht klebrige Oberfläche gepustet werden und das Bild fortan verunzieren.
Es gibt natürlich auch IR- und andere Durchlauftrockner, aber die kosten ein paar Euro.
Nasses Barytpapier ist weich und formbar. Wenn Sie einen nassen Barytprint an einer Ecke auf die Wäscheleine hängen, wird das Blatt entlang seiner Diagonale durch sein eigenes Gewicht ein wenig in die Länge gezogen. Es wird nota bene nur die Diagonale nennenswert länger, weil nur an ihr das Gewicht des Papiers zerrt. Die Seiten bleiben im Wesentlichen gleich. Das aber heißt, dass Pythagoras, der alte griechische Mathematiker, der einmal festgestellt hat, dass zu zwei rechtwinklig aufeinander stehenden Seiten nur eine ganz bestimmte Verbindungslinie zwischen den Endpunkten passt, sauer wird, und das Papier muss sich krümmen, und zwar in einer Weise, die Sie kaum wieder reparieren können, wenn Sie ein Bild so bis zur vollständigen Trocknung malträtiert haben.
Die weiche Oberfläche nasser Gelatine ist formbar. Das heißt einerseits, dass sie leicht beschädigt wird, wenn Sie sie mechanisch beanspruchen. Aber: Wenn man Barytbilder im Kontakt mit einer richtig glatten Oberfläche, z.B. hochglanzpoliertem Metall, hochwertigem Glas oder Kunststoff, trocknen lässt, bekommen die Bilder einen spiegelnden Hochglanz, der insbesondere die Schattenwiedergabe fördert. (Siehe dazu auch Stichwort „hohe Schwärzung“ im Teil 1 des FAQ.) Die Hochglanztrocknung muss nicht auf einer Presse geschehen; sie funktioniert auch - nur langsamer - bei Raumtemperatur. In meiner fotografischen Anfangszeit („Damals in den Ardennen...“) wurde noch in vielen Büchern beschrieben, wie man ein Bild auf eine saubere (!) Glasscheibe aufquetscht und trocknen lässt. Wenn man das abends tat, sollte das Papier aus eigenem Willen über Nacht abfallen. Tat es das nicht (z.B. weil die Glasscheibe nicht sauber war) so war das Bild i.Allg. unrettbar versaubeutelt.
Einen wirklich sauberen Hochglanz hinzubekommen, gleich ob auf einer Hochglanzpresse oder per Raumtemperaturtrocknung, ist schon eine Arbeit, die viel Sorgfalt erfordert. Viel kann schief gehen, und in aller Regel sind die Resultate irreversibel, d.h. ein toller Print, fehlerhaft hochglanzgetrocknet, ist nur noch für die Tonne geeignet. Vielleicht wird die Hochglanztrocknung deswegen nicht mehr gar so oft praktiziert.
Wie ist das eigentlich mit dem „säurefreien“ Papier?
Stichworte:
• Zerfallsmechanismus von Papier
• säurefrei/holzfrei
• Pufferung
• Schadstoffe
Mit der Haltbarkeit von Fotos habe ich mich schon verschiedentlich befasst, allerdings primär unter dem Gesichtspunkt der Haltbarkeit des Silber- oder Tintenbildes. Das ist auch sinnvoll, da es das schwächere Glied in der Kette ist. Wie erst in der letzten Kolumne erläutert, kann man hinsichtlich des Trägers nicht eindeutig PE- oder Barytpapiere als die „besseren“ ausmachen.
Bei Papier im Allgemeinen wird es als wichtig angesehen, dass es „säurefrei“ ist. Wenn wir aber unser Papier durch die fotografischen Suppen ziehen, ist meist auch ein saures Stoppbad dabei. Gefährden wir damit die Haltbarkeit unserer Bilder? Mitnichten. Die Essig- oder Zitronensäure des Stoppbades wird im Zuge der weiteren Verarbeitung, insbesondere während des Wässerns, schnell und vollständig entfernt, da sie keine Neigung hat, sich in Gelatine oder Träger zu verkrallen.
Schauen wir uns aber einmal die Herstellung von Papier an: Hauptzutat von Papier sind Zellulosefasern, und bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das meiste Papier durch das Recycling von Leinen- und Baumwollfasern aus Lumpen (Hadern) hergestellt. In neuerer Zeit (und speziell seit Einführung des „papierlosen Büros“, so scheint es mir manchmal) ist der Papierbedarf offenbar so groß, dass das nicht mehr ausreicht. Es mag auch hinzukommen, dass heute viele Kleidungsstücke aus Mischfasern oder ausgerüsteten Fasern bestehen und sich daher nur noch bedingt für ein solches Recycling eignen. Jedenfalls wird Papier heute zum großen Teil aus Holzfasern hergestellt. Holz besteht etwa zur Hälfte aus Zellulose, nächster Hauptbestandteil ist Lignin, ein der Zellulose verwandtes Material. Für die Papierherstellung muss alles außer der Zellulose entfernt werden, speziell auch das Lignin, da es die Neigung hat, im Laufe der Zeit zu zerfallen und dabei Säure zu erzeugen, das Papier brüchig zu machen und Verfärbungen hervorzurufen. Genau das ist denn auch der Grund, warum hochwertige Papiere als „holzfrei“ bezeichnet werden. Der heute scheinbar üblichere Begriff „säurefrei“ scheint mir nicht so passend wie „ligninfrei“ (oder eben „holzfrei“). Er gibt Anlass zu Missverständnissen. Vor längerer Zeit las ich in einem Artikel über Edeldrucke längliche Ausführungen eines (nicht eben wenig schreibenden) Autors, wonach durch langes Wässern praktisch alle Probleme mit Säure im Papier gleich automatisch mit gelöst wären, denn die Säure und alles andere, was dem Bild schaden könnte - so der Autor - würde ja ausgewaschen. Ganz offensichtlich hat besagter Autor schlaues Wasser, das weiß, was dem Papier schadet: Es lässt die Gelatineschicht der Emulsion und die Schlichte (Leim aus Stärke oder Gelatine) im oder auf dem Papier und löst nur die schädliche Säure auf. Meinem Leitungswasser traue ich diese Intelligenz nicht zu, und wenn im Papier produktionsbedingt Lignin enthalten ist, so schafft es mein Wasser mit Sicherheit nicht - und ich wage zu behaupten, Ihres auch nicht -, es herauszulösen, gleich, ob ich eine Stunde oder einen Tag lang wässere. Und dann zerfällt das Lignin irgendwann und erzeugt Säure, die vorher nicht da war. Das ist mein zweiter Kritikpunkt am Begriff „säurefrei“: Kann gut sein, dass Papier beim Kauf säurefrei ist. Wenn aber die Säure später nachproduziert wird, habe ich davon rein gar nichts.
Um diese nachträgliche Fabrikation von Säure im Papier unschädlich zu halten (und von außen kommende zu neutralisieren), werden manche Papiere gepuffert, d.h. man baut ein schwaches Alkali ins Papier ein, das mit entstehender Säure reagiert und sie neutralisiert. Dafür kann man z.B. schwache Magnesiumcarbonatlösungen verwenden, aber ich befürchte, das Magnesiumsalz würde wirklich im Zuge einer längeren Wässerung ausgewaschen. Bei der Nachbehandlung von Fotos zu konservatorischen Zwecken - so schreibt William Crawford in The Keepers of Light - benutzt man jedenfalls, anders als bei Büchern, auch deswegen keine Pufferlösungen, weil die Dank ihrer Alkalinität die Gelatine aufweichen lassen könnten. Dann wäre vielleicht das Papier gerettet, aber das Foto nicht mehr drauf. (Operation gelungen, Patient tot.)
Weitere Quellen von Bild und Träger schädigender Säure und anderen Chemikalien sind
• alle Arten von Klebstoffen (Viele enthalten Schwefelverbindungen und praktisch alle enthalten Lösemittel.),
• Aufbewahrungskisten und Rahmen aus Holz (Insbesondere Weichhölzer enthalten viel Harz und verdunsten Terpene.),
• Schmiermittel in Scharnieren bei metallenen Aufbewahrungskassetten,
• heimische Putz- und andere Chemikalien (z.B. Haarsprays usw.);
• und, und, und...
Um dem ganzen die Krone aufzusetzen, muss man noch wissen, dass - so sagte mir jedenfalls ein renommierter Hersteller - die meisten für Fotopapiere verwendeten Träger nicht einmal wirklich „säurefrei“ sind.
Fazit: Wer absolut archivtaugliche Bilder haben möchte, wird mit Papier nicht wirklich glücklich. Beständiger ist z.B. ein Polyesterträger, wie er z.B. für MACO EXPO Display genutzt wurde. (Suchen Sie es nicht im Laden, es wird aufgrund von Fertigungsproblemen nicht mehr produziert.) Polyester - das wurde schon bei Filmen erwähnt - kann extrem lange „leben“, nämlich bis zu 500 Jahren.
Man kann also eine Menge „Gegenanzeigen“ formulieren, aber nicht eindeutig ein Trägermaterial als das Beste identifizieren. Darüber hinaus kann man versuchen, bei den Herstellern durch Kundenanfragen Problembewusstsein zu schaffen. Fragen wir doch einmal Agfa, Bergger, Foma, Forte, Ilford, Kentmere, Kodak, MACO, Oriental, Tetenal, Wephota und wie sie alle heißen, was für Papierträger sie verwenden. Nur so erfahren die Herrschaften, dass es uns überhaupt interessiert.
Zu PE-Papier: Ich bevorzuge Multigrade IV, weil es von der Seite betrachtet nicht so komisch schimmert. Ist das heute bei allen Herstellern so?
Verwandte Frage:
Was ist 'Blooming' und wie kann der Effekt verhindert werden?
Stichworte:
· Heiß-/Kalttrocknung
· Blooming
Was Sie ansprechen, ist der so genannte Blooming-Effekt: An Stellen hoher Silberdichte scheint, von der Seite gesehen, ein Belag auf der Papieroberfläche zu liegen. M.W. tritt der Effekt ausschließlich oder zumindest hauptsächlich bei glänzendem Papier auf. Er kommt - diese Erklärung habe ich einmal gehört - dadurch zu Stande, dass an Stellen hoher Dichte Silberfädchen wie kleine Härchen durch die Oberfläche dringen. Der Effekt ist natürlich unerwünscht, und die Papierhersteller versuchen etwas dagegen zu unternehmen. Aber auch bei Papieren, wo der Effekt stark auftritt, lässt er sich durch Warmtrocknung mit einem IR-Durchlauftrockner beseitigen. Dadurch wird die Papieroberfläche weich, und die Fädchen versinken oder legen sich flach (vereinfacht gesprochen).
Gibt es Beispiele für einige typische Fehler und ihre Auswirkung, insbesondere mit Bildern von diesen und ihre Vermeidung bzw. die Umkehr, wenn mein Print das und das aufweist, was kann die Ursache sein? (Evtl. unter Verwendung von Scans der Leser)
Stichworte:
• Lerneimer
Klar gibt es die, nur leider habe ich die meisten davon meinem „Lerneimer“ (Schöpfung von Tim Rudman) überantwortet. Viele der potenziellen Fehler stecken schon an einigen Stellen in diesem Text unter den jeweiligen Fragen und Antworten. Aber Sie haben natürlich Recht: Man kann die Fehler anschaulich am besten mit Beispielen vermitteln. Das wäre vielleicht eine Anregung für eine ganze weitere Kolumne. Wenn Sie etwas beisteuern möchten, senden Sie mir eine Mail. Ich schicke Ihnen dann meine Postanschrift, und Sie können mir unter Angabe der Verarbeitungsparameter (soweit Sie sie wissen) ein misslungenes Bild schicken. (Das gilt natürlich nicht nur für Fehler unter der Überschrift „Papier“, sondern für alles Mögliche.) Ich werde Ihnen, wenn ich eine plausible Vermutung über die Fehlerursache habe, sofort antworten, alle eingehenden Beispiele sammeln und versuchen, daraus irgendwann eine Kolumne zu basteln.
Woran erkennt man, dass das Papier gealtert ist [nachdem meist (?) keine Jahreszahl auf die Schachtel gedruckt wird]?
Verwandte Frage:
Wie groß ist die Lagerfähigkeit im unbelichteten Zustand (Unterschiede Baryt/PE und Kontrastwandelpapiere/feste Gradation)?
Stichworte:
• Jahresangaben/Losnummern
• Lagerfähigkeit
Auch wenn in den meisten Fällen keine Jahreszahl auf die Schachtel gedruckt ist, sollte sich eigentlich immer eine Losnummer (engl.: Batch number, frz.: Numéro de lot) auf der Schachtel befinden. Fragen Sie beim Hersteller an, wann die Charge gefertigt wurde. Er sollte es Ihnen gerne sagen. Außerdem lernt er vielleicht durch die Anfragen, dass es sinnvoll wäre, gleich die Jahreszahl aufzudrucken. Das würde ich sehr begrüßen, denn mit der Losnummer kann ich allenfalls hinterher feststellen, dass mir ein Krautladen eine Packung angedreht hat, die schon lange herumgelegen hat. Mit einem Herstellungsdatum hätte ich das im Laden erkannt und dem Händler das Zeug gleich vor die Füße geschmissen.
Allerdings hält Fotopaper recht lange, wenn Sie es gut behandeln. 2 Jahre sind nach meinen Erfahrungen überhaupt kein Problem. „Gut behandeln“ heißt: Trocken lagern, nicht in der Nähe von Chemikalien, nicht zu warm.
Wie ändert sich das Papier beim Altern? (Änderung der Bildspurzeit, Reduktion der erreichbaren Schwärzen, Vorhandensein eines generellen Grauschleiers, ......)
Verwandte Frage:
Wie ist gealtertes Papier zu verarbeiten (andere Entwickler, andere Fixierer...)
Stichworte:
• Alterseffekte
• Wiederbelebung von altem Papier
Es gibt mehrere Effekte:
1. Das Papier „verweichlicht“. Harte Festgradationen und die härteste Gradation bei kontrastvariablem Papier trifft es zuerst. Sie werden weicher. Ein bekannter Hersteller drückte es einmal in einem Telefonat so aus: „Wenn du Gradation 4 kaufst und ein halbes Jahr ohne Kühlung liegen lässt, kannst du froh sein, wenn du noch Gradataion 3 hast.“ Das mag ein wenig überzogen sein, aber im Trend stimmt’s wohl. Dem lässt sich noch recht gut durch Verwendung härterer Entwickler entgegenwirken. Beispiele hierfür sind (in der Reihenfolge zunehmender Wirkung):
• stärker als üblich konzentrierter normaler Entwickler und/oder längere Entwicklungszeit,
• Tetenal Dokumol (zusätzlich mit deutlicher Abkühlung des Bildtons bei Warmtonpapier),
• LP-DOCUFINE HC („HC“ ist „high contrast“, nicht verwechseln mit „LC“ = „low contrast“) oder AMALOCO AM 30G
2. Das Papier bekommt einen Schleier, d.h. die Weißen sind nicht mehr richtig weiß. Dafür können verschiedene Faktoren verantwortlich sein, z.B. chemische Verschleierung, z.B. durch Dukachemie (Schwefelwasserstoff aus Brauntoner ist eine berüchtigte Quelle.), Verschleierung durch kosmische Strahlung, durch Wärme usw. Dem ist nur bedingt entgegenzuwirken. Helfen soll eine Zugabe des in Entwicklern ohnedies oft anzutreffenden Benzotriazols. Probiert habe ich das allerdings noch nicht. Helfen kann auch eine etwas aggressivere Entwicklung, gefolgt von einem kurzen (!) Bad in recht verdünnter Bleiche, z.B. Farmerschem Abschwächer.
Andere Fixierer brauchen Sie m.E. nicht.
Was ist und was bewirkt der „Bildsilberstabilisator“ Sistan von Agfa?
Stichworte:
• Bildzerfall durch Oxidation
• Konservierung
• Schwefeltoner
• Selentoner
Agfa Sistan ist - halten Sie sich fest - eigentlich ein Fixieragens, aber eines, das nicht ausgewaschen wird und trotzdem nicht schadet. Lassen wir die chemischen Details einmal beiseite und konzentrieren uns auf die Anwendung und Wirkung: Die Zerstörung des Silberbildes geschieht durch Oxidation des elementaren Silbers, aus dem sich das Bild zusammensetzt, zu Silberionen. Das elementare Silber ist im Bild nicht beweglich. Die Silberatome bleiben, wo sie sind. Anders die Ionen. Sie können wandern. Eine Auswirkung davon ist z.B. ein Silberspiegel auf dem Bild: Silberionen wandern zur Bildoberfläche, wo sie auch wieder zu elementarem Silber reduziert werden können, und schon hat man Silber als Spiegel auf dem Bild. Es gibt noch andere Effekte wie z.B. Sulfidbildung (braune Flecken). Sistan ist nun eine Mischung aus einem Netzmittel und einem Stabilisator, dessen Wirkung darin besteht, dass er jedes freie Silberion, das im Bild herumschwirrt, sofort einfängt und so daran hindert, sich als Silberspiegel auf der Bildoberfläche niederzuschlagen, als Silbersulfid braune Flecken zu ergeben oder als „Geisterbild“ auf der Bildrückseite aufzutauchen. Dazu wird Sistan als allerletztes Bad, ganz wie ein Netzmittel, angewendet. Es wird nichtausgewaschen. Agfa hat - so habe ich schon vor einigen Jahren vom zuständigen Bearbeiter bei Agfa gelernt - eigene Tests zur Wirksamkeit unternommen, die belegen, dass Sistan wirkt. Im kleinen Rahmen hat Ctein (s. sein Buch Post Exposure und einen entsprechenden Artikel in Photo Techniques USA) die Wirksamkeit nachgewiesen, und aus „gut unterrichteten Quellen“ weiß ich, dass es inzwischen auch einen Test beim IPI (Image Permanence Institute) gegeben hat, der die Wirksamkeit belegt. (Was ich nicht weiß, ist warum Agfa diesen Test nicht werbewirksam ausschlachtet.)
Andere Wege der Stabilisierung sind
• Schwefeltoner (gleich ob giftig stinkender Toner [z.B. Tetenal Schwefeltoner oder Agfa Viradon] oder geruchloser, dafür auf krebsverdächtigem Thiocarbamid basierender [z.B. Triponaltoner]) wirkt schon bei Teiltonung recht zuverlässig schützend. Silbersulfid ist so ziemlich die stabilste Silberverbindung, die es gibt, und auch durch aggressive Chemikalien in der Umwelt kaum wieder kaputt zu kriegen.
• Selentoner, z.B. Kodak Rapid Selenium Toner, AMALOCO T 60 oder LP-SELENIA soll lt. Ansel Adams und anderen angeblich auch bildstabilisierend wirken. Der Mechanismus ist ähnlich wie beim Schwefeltoner: Selen ist ein zu Schwefel homologes Element, und so ist auch Silberselenid recht stabil. Allerdings besteht ein gravierender Unterschied: Selentoner tont die hellen Bildpartien nur sehr, sehr langsam. Schon seit Jahren vertritt man bei Agfa nach hausinternen Tests die Meinung, dass Bilder, die mit Selen nur „angetont“ wurden (z.B. 1+20, 2 min), wie es z.B. Ansel Adams zur Erhöhung des Dmax empfiehlt, die aber nicht so lange getont wurden, bis in allen Grauwerten ein deutlicher Bildtonumschlag (und damit einhergehend Verlust der Dichteerhöhung) eingetreten ist, auch nicht wesentlich stabiler sind als ungetonte Bilder. Zudem ist Selen ziemlich giftig.
Der besondere Vorteil von Sistan gegenüber anderen Stabilisatoren (s. auch meinen Artikel „Eine Frage des guten Tons“) besteht darin, dass Sistan keinerlei Wirkung auf den Bildton hat und m.W. mit allen Nachbehandlungen wie Retusche usw. kompatibel ist, soweit sie kein Auswaschen des wirksamen Agens involvieren.
Warum ist das Bildsilber im Fotopapier überhaupt so angreifbar? Nun, es ist eine alte Weisheit, dass niedrige Empfindlichkeit und feines Korn zusammengehören. Die Silberkörner in Fotopapieremulsionen sind feiner als alles, was Ihnen als Film in die Finger fallen wird. Feine Körner haben aber eine besonders große Oberfläche, an denen sie von Chemikalien angegriffen werden können. Muss ich weiter schreiben?
Eines der bei Beständigkeitstests im Hause Agfa haltbarsten Papiere war - das passt genau ins Bild - ein Kalttonpapier. Warum? Je feiner die Bildsilberkörner, desto wärmer der Bildton. Kaltes Papier bedeutet grobes Korn, und das wiederum bedeutet weniger Angriffsfläche für aggressive Chemikalien.
Sistan ist aus meiner Sicht aus demselben Grund auch für extrem feinkörnige Filme zu empfehlen. Das steht auch in meinem Artikel zu den hochauflösenden Filmen (Ein paar Linienpaare mehr ...)
Wie lange können welche Barytpapiere im Wasser bleiben?
Bei mir erfolgt die Wässerung erst nach dem Schlafen am nächsten Tag. Das habe ich so bei einem Fine-Printing-Kurs gelernt! Hatte mit MCC 111 auch NOCH NIE ein Problem mit Ablösen der Schicht, usw.
Stichworte:
• Schlafmangel
• schlechte Praxis
• unbegründete Meinungen
Verlangen Sie bitte nicht von mir, dass ich Ihnen austeste, nach welcher Zeit welches Papier sich wie verzieht, zerfällt oder erst auf lange Sicht merkbare Schäden davonträgt. Ich kann Ihnen hier nur folgende Informationen geben, um einen Trend deutlich zu machen:
Wenn Papier lange im Wasser liegt, wird es dadurch nicht besser. Papier ist geleimt, und der Leim wie auch die Gelatine quellen im Wasser auf, der Leim kann teilweise ausgespült werden. Die Papierfasern quellen auf und werden extrem weich, so dass sie schneller reißen können. Optische Aufheller, die dem Papier zugesetzt werden, um sein Weiß weißer zu machen, werden ausgewaschen.
So gerne ich nach einem langen Abend in der Duka ins Bett will, ich lasse meine Papiere nie unnötig lang im Wasser liegen. Vielleicht haben Sie noch nie ein Problem gehabt, aber vielleicht liegt das auch daran, dass der bewusste „Fine-Printer“-Kurs noch nicht so lange zurück liegt.
Es mag Papiere geben, die eine solche Misshandlung zunächst scheinbar unbeschadet überstehen, aber gut ist ein solches Vorgehen m.E. auch für solche scheinbar robusten Papiere nicht. Veröffentlichungen dazu sind mir nicht bekannt, wären aber auch nur begrenzt hilfreich, da Papier nicht gleich Papier ist. Auch kann ich’s nicht durch Versuche belegen, sondern lediglich durch den Hinweis darauf, dass übermäßiges Waschen in den meisten Datenblättern von Papier, die mir untergekommen sind, kontraindiziert ist.
Ich lehne mich einmal aus dem Fenster und sage Ihnen ganz unverblümt, dass, ob das Etikett „Fine-Printer“-Kurs darauf klebt oder nicht, eine solche Misshandlung von Fotos nach meinem Verständnis eine ganzschlechte, unprofessionelle Praxis ist.
Ich habe mich beim Einstellen meines Vergrösserungsrahmens auf das Papierformat schon oft gefragt, wieso die Hersteller eigentlich keine Papiere mit dem gleichen Seitenverhältnis (Länge x Breite) wie die Negativformate sie besitzen herstellen.
Stichworte:
• Historie
Ich auch. Ende der Antwort.
Nicht zufrieden? OK, noch ein bisschen mehr: Die bekanntesten der gängigen Papierformate gehen vermutlich auf historisch gewachsene Plattengrößen, auf „runde“ Zollgrößen, den goldenen Schnitt und sonstige Konstrukte zurück, die die jeweiligen Hersteller für sinnfällig hielten. Daraus hat sich schon vor der Etablierung des heute dominanten KB-Formats mit dem Seitenverhältnis 2:3 ein Quasistandard entwickelt, gegen den kaum anzustinken ist. Und selbst wenn man jetzt Papiere in vielen Größen mit dem Seitenverhältnis 2:3 anbietet, dann sind die Besitzer von KB-Kameras und 4,5x6-Kamers glücklich, aber die von 6x6- und 6x7-Kameras und 4x5-Zoll-Kameras frustriert. Also irgendwer ist immer unzufrieden, wenn die Anzahl der Formate begrenzt ist. Jedes mögliche Seitenverhältnis können die Hersteller nicht anbieten. Also bleibt man bei bestimmten, historisch gewachsenen Formaten und lässt ein bisschen Verschnitt zu. Aus meiner Sicht ist das nicht schlimm. Ich brauche immer etwas weißen Rand, in jedem Fall als Griffzone für die Zange, bei Baryt zusätzlich zum Trocknen, bei PE zum Abschneiden, um die Eindiffusionszone der Chemie nahe den Schnittkanten zu entfernen. Denn was da an Chemie drin ist, ist durch Wäsche nicht mehr zu beseitigen.
Damit beschließe ich Teil 2 meines FAQ und danke Ihnen für Ihre Fragen. Sie sind stets willkommen, mir weitere Anregungen, Kommentare und Fragen zu schicken.
Wollsteins Fotopapier-FAQ - Teil 1
Thomas Wollstein
März 2004
Ich glaube, es war eine gute Idee, Sie, liebe Leserinnen und Leser, um Mitarbeit bei dieser Kolumne zu bitten. Sie haben mir eine Menge Fragen vorgegeben, auf die ich allein nie gekommen wäre. Daher möchte an dieser Stelle allen Leuten danken, die Fragen zu dieser Kolumne beigetragen haben. Als Ergebnis möchte ich Ihnen nicht einen, sondern zwei Beiträge vorlegen, von denen ich hoffe, dass es mir darin gelungen ist, Ihre Fragen in einer Weise zu beantworten, die Sie zufrieden stellt.
Ich konnte nicht alle Fragen erschöpfend beantworten. Zum Teil liegt das daran, dass es (z.B. in Fragen des Geschmacks) keine allgemeingültige Antwort gibt, zum anderen an Wissenslücken, die ich bis heute nicht schließen konnte. Aber sehen wir es locker: Ich will Sie ja auch nicht erschöpfen, sondern erfreuen.Ich konnte auch nicht alle Fragen in einem einzigen FAQ beantworten. Dazu waren es einfach zu viele, und ich habe zu wenig Zeit, jeden Monat so viel zu recherchieren und zu schreiben. In diesem ersten Teil werden Sie daher zunächst Fragen zu folgenden Punkten finden:
• Allgemeines
• Nassverarbeitung bis einschließlich Wässerung
• Papierkennwerte wie Bildton, Maximaldichte usw.
• Selentonung
Dem zweiten Teil des FAQ bleiben folgende Schwerpunkte vorbehalten :
• Gealtertes Papier
• Trocknung
• Konservierung
Wie faltet man die schwarzen Tüten um das Fotopapier so, dass man den Packen wieder ohne Gewalt in die Schachtel bekommt?
Stichworte:
• Handhabung
Auf die Frage habe ich gewartet! Ich kann Ihnen zwei pragmatische Lösungen anbieten, die beide keine Ausbildung in Origami, der japanischen Kunst der Papierfalterei voraussetzen:
Lösung 1: Ecken der Pappschachteln mit Klebeband verstärken. Damit bekommt man zwar das Papier auch nicht gewaltlos in die Schachtel, aber wenigstens bleibt die Schachtel heil. Schäden am Papier habe ich mir auf diese Weise noch nicht eingehandelt.
Lösung 2: Sie werfen leere Schachteln nicht weg und nehmen einfach die nächstgrößere Schachtelgröße, d.h. 20x25 für Papier 18x24 usw.
Wie sieht es mit der Papierempfindlichkeit aus: Wie wird sie angegeben und was besagt sie?
Stichworte:
• Papierempfindlichkeit
• ISO P-Wert
• Mitteltöne
Auch für die Papierempfindlichkeit gibt es eine genormte Angabe, den so genannten ISO P-Wert, den Sie in den „Begleitpapieren“ des Papiers finden. Dass er nicht so gehandelt wird wie die Filmempfindlichkeit, liegt daran, dass seine Bedeutung nur im Vergleich von Papieren zum Tragen kommt, nicht aber, wenn Sie einfach vergrößern.
Wenn ich zwei Papiere habe, von denen eines als ISO P100, eines als ISO P200 angegeben ist, weiß ich, dass dasjenige mit ISO P200 doppelt so empfindlich ist.
Aufpassen muss man allerdings in folgendem Punkt: Bei Filmen ist die Empfindlichkeit auf die Schattendichten bezogen, da der Kontrast durch die Entwicklung angepasst wird (s. Frage zur Entwicklungszeit von Papieren). Bei Papieren ist die Empfindlichkeit aber auf einen Mittelton (D = 0,6) bezogen. Das muss man im Kopf haben, wenn man bei Kontrastwandelpapieren Gebrauch von der Tatsache machen möchte, dass – so formuliert es der Hersteller meist – alle Gradationen außer 4 und 5 gleich empfindlich sind:
Bei einem Gradationswechsel bleiben die Mitteltöne konstant, die Schatten und die Lichter werden bei härterem Papier auseinander getrieben, bei weicherem zusammengezogen.
Welche Papierstärke ist sinnvoll?
Stichworte:
• Papierstärken
• Handhabung
• Beschädigungen
• Planlage
Das kommt natürlich darauf an, was Sie mit dem Bild vorhaben. Wollen Sie das Bild aufziehen und rahmen, ist die Papierstärke für das Endprodukt ziemlich unerheblich.
Die Vorteile dünnen Papiers sind schnell aufgezählt:
+ geringeres Gewicht
+ weniger Chemikalienverschleppung
+ kürzere Trockenzeit
Dem stehen allerdings auch Nachteile gegenüber:
- Das nasse Papier hat überhaupt kein „Rückgrat“ und ist extrem reiß- und knickanfällig. Während normal dickes nasses Papier noch ein bisschen Reststeife aufweist, ist dünnes Papier wirklich nur ein nasser Lappen und daher bei der Verarbeitung sehr gefährdet.
- Luftgetrocknetes dünnes Papier ist meist so wellig, dass einem die Tränen kommen.
Das gilt im Wesentlichen nur für Barytpapier. Die PE-Papiere, die ich bisher in den Fingern hatte, würden alle als hinreichend „dick“ und stabil gelten.
Fangen wir bei den dicken Papieren mit den Nachteilen an:
- Sie sind schwer. Das merken Sie insbesondere beim Einkaufen und Lagern.
- Sie sind teilweise recht bockig. Leichtgewichte unter den Vergrößerungsrahmen werde manchmal nicht mit ihnen fertig.
- Sie sind - wie ein bekanntes Küchentuch - dick & durstig. D.h. der Entwickler schwindet im Zuge einer Duka-Sitzung merklich dahin, was bedeutet, dass mehr von ihm in nachfolgende Bäder verschleppt wird. Bei dickem Barytpapier ist also ein saures Stoppbad angeraten.
- Sie trocknen langsamer als dünne Papiere.
Vorteilhaft ist aber:
+ Dickes Papier hat – in Umkehrung der Nachteile dünner Papiere - mehr „Rückgrat“, wird also bei der Verarbeitung nicht so leicht beschädigt.
+ Es ist nach einer Lufttrocknung längst nicht so wellig wie dünnes Papier, und die vorhandenen Wellen lassen sich oft durch Pressung in einem Buch beseitigen.
+ Wenn Sie aber ein dickes Papier glatt getrocknet haben, dann hat es auch „Stehvermögen“, und sie brauchen es nicht aufzuziehen, sondern können es „einfach so“ rahmen.
+ Es wirkt „wertiger“. Schlabberig dünne Bilder, die aussehen wie auf Schreibmaschinenpapier gedruckt, machen einen minderwertigen Eindruck.
Früher war eine Klassifizierung der Papiere als „papierstark“, „halbkartonstark“, „kartonstark“ und „doppelkartonstark“ üblich. Heute ist diese Einordnung nicht mehr sehr üblich. Bei dem von mir recht häufig verwendeten Forte Polywarmtone Plus FB steht drauf, dass der Träger als „Museum-Schwerkarton“ gilt. Trotzdem ist das ebenfalls in meinem Portfolio häufige MACO EXPO RN schwerer.
Fast alle Barytpapiere, die Sie heute im Laden kaufen, sind in etwa mindestens „kartonstark“ und hinreichend steif. Die wirklich dünnen Papiere sind die Ausnahme. Ausnahmen sind Spezialpapiere. Bei PE stellt sich das Problem nicht in dem Maße, s.o.
Fazit: Auf diese Frage bekommen Sie eine wischi-waschi-Antwort. Die üblichen Papierstärken sind von der Handhabung her durchaus in Ordnung. Besonders dünnes Papier zu kaufen macht m.E. nur dann Sinn, wenn es als Spezialpapier nur in dieser Stärke verfügbar ist, hat aber sonst eher Nachteile.
Welches Dukalicht ist für Kontrastwandelpapiere geeignet?
Ist dieses Licht für Kontrastwandelpapiere aller Hersteller geeignet?
Ich glaube, die Hersteller empfehlen von Rot über Braun und Grün fast alles.
Stichworte:
• Rotlicht
• Kontrastwandelpapier
Stimmt. Aber eine Regel gibt es doch: Wenn man einmal von Spezialitäten wie panchromatischem Papier (zum Vergrößern von Farbnegativen auf SW) absieht, ist jedes Fotopapier rotblind. Rotes Dukalicht ist also immer OK.
Grünes ist bei kontrastvariablem Papier nicht OK. Kontrastwandelpapier hat mehrere Emulsionen, manchmal wirklich einzelne, getrennte Schichten, manchmal einen Mischmasch von bis zu drei Emulsionskomponenten in einer einzigen Schicht. Um die Emulsionskomponenten - hart und weich - trennscharf ansprechen zu können, wird folgender Weg gegangen: Man macht die harte Emulsion für Licht einer Farbe empfindlich, das die weiche Emulsion nicht sieht, und umgekehrt. Rot wird dabei nicht benutzt, wohl aber grün. Aus diesem Grund sind Kontrastwandelpapiere für grünes Licht wesentlich empfindlicher als Festgradationspapiere, und die beliebten gelbgrünen Dukalampen taugen hier nichts. (Dass grünliches Licht so beliebt ist, liegt vermutlich daran, dass unser Auge im grünen Spektralbereich am empfindlichsten ist, was bedeutet, dass man mit weniger Licht mehr sieht als bei anderen Farben.)
Da alle Papierhersteller mit Wasser kochen, will sagen: dieselbe Physik nutzen, lässt sich eine Lampe mit dem Filter Ilford 902 oder dem gleichwertigen Kodak-Filter OC in der Regel auch für alle Konkurrenzprodukte benutzen. Es mag sein, dass das eine Papier gegenüber der einen oder anderen Lampe ein wenig in der Empfindlichkeit variiert, aber nach meinen Erfahrungen nicht wirklich gravierend.
Stimmt mein Eindruck, dass manche Papiere empfindlicher gegen mechanische Einflüsse sind als andere oder handelt es sich hier nur um ein zufälliges Zusammentreffen ungünstiger Umstände? (...)
Stichworte:
• Mechanische Beschädigung
• Randzone
• Fabrikate
• Umetikettierung
• Nobelmarken
Bestimmt stimmt Ihr Eindruck. Die Empfindlichkeit der Oberfläche hängt u.a. von der Härtung ab, die der Hersteller der Gelatine angedeihen lässt. Sie hängt allerdings auch von der Behandlung des Papiers bei Ihnen ab. Im Zuge der Verarbeitung quillt die Gelatineschicht des Bildes erheblich auf und wird dabei weicher und verletzlicher. Sie nimmt ein Vielfaches ihres eigenen Gewichts an Wasser auf. Hoch konzentrierte Salzlösungen und stark saure oder alkalische Lösungen führen dazu, dass die Gelatine extrem stark quillt. Eine hohe Temperatur der Verarbeitungslösungen oder der Schlusswässerung bedeutet ebenfalls ein höheres Risiko mechanischer Beschädigungen. Das ist einer der Gründe, warum ich Ihnen empfehle, immer mit großzügigem Rand zu arbeiten. Er dient nicht nur als Greifzone für die Zangen, sondern auch als Schleierkontrolle, bei Barytpapier zum Trocknen (Nassklebeband) und bei PE-Papier als abzuschneidende Sicherheitszone für eindiffundierende Chemie.
Was nun die in der Frage konkret genannten Produkte betrifft: Vieles ist heute nicht mehr das, was auf der Packung steht. Zumindest nicht ursprünglich. Will sagen: Ich weiß es im konkreten Fall nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass Amaloco-Papier nicht von Amaloco hergestellt wird. Es könnte tatsächlich Ilford-Papier sein, und in diesem Fall hätten die unterschiedlichen Reaktionen, die Sie beobachtet haben, andere Gründe. Das können Sie am leichtesten durch eine Mail an Amaloco herausfinden. (Überhaupt bin ich der Meinung, wir Kunden meckern viel zu wenig.)
Das Umetikettieren von Produkten ist übrigens aus meiner Sicht nichts Verwerfliches. Gar zu oft wurde im Hobbylaborforum darüber diskutiert, als handele es sich um Betrug. Wenn überhaupt, dann umSelbstbetrug. Als Kunde kann es mir doch völlig egal sein, ob auf meinem Kentmere-Papier Kentmere oder Tetenal steht, auf meinem Forte-Papier Forte oder Bergger oder auf meinem Agfa-Papier Agfa oder Tura. Die Liste ließe sich fast beliebig erweitern und ist nicht auf die Fotobranche beschränkt. Es sind halt die Produktionsstätten für Fotomaterial aller Art recht teuer, und noch teurer sind die Leute, die drin arbeiten. Daher gibt es nur noch wenige Fabriken, die fast alle Hersteller beliefern.
Es wäre natürlich unangenehm, wenn ich für Papier X als Marke X mehr bezahlen müsste als für Papier X als Marke Y. Andererseits finde ich auch nichts dabei, wenn dasselbe Papier bei unterschiedlichen Anbietern unterschiedliche Preise hat, oder?
Der Aspekt Selbstbetrug kommt dann zum Tragen, wenn ich dem Zauber des schönen Namens verfalle und glaube, dass Nobelmarke X besser ist als Popelmarke Y und dadurch mehr bezahle.
Warum entwickelt man Fotopapier nicht (wie Film), bis das Bild gut aussieht?
Stichworte:
• Ausentwicklung
• Maximaldichte
• Maximalschwärzung
Die Entwicklungsvorgänge bei Film und Fotopapier sind völlig unterschiedlich: Film wird so entwickelt, dass das Fotopapier den Kontrast zwischen der durchsichtigsten und der am wenigsten durchsichtigen Stelle des Negativs noch verkraftet, d.h. wiedergeben kann. Wenn ich ein Negativ so entwickeln würde, dass die dichteste Stelle die höchste mit dem Film mögliche Dichte erreicht, würde vermutlich kein Papier es schaffen, diesen Kontrast zu bewältigen. Ein Negativ wird praktisch nie bis zur maximal möglichen Dichte entwickelt.
Um nun den Wiedergabebereich des Papiers optimal auszunutzen, muss dazu die dünnste Stelle des Negativs so schwarz wiedergegeben werden wie eben möglich, während die dichteste Stelle des Negativs so weiß wiedergeben wird wie eben möglich. Die Enden der Skala liegen also fest, und beim Papier muss man sich Mühe geben, das schwärzeste mögliche Schwarz zu erzielen. Das aber wird man nur schaffen, indem man ausentwickelt, d.h. so lange entwickelt, bis sich nicht mehr viel am Bild tut. Entwickelt man kürzer, so erreicht man nicht die maximal mögliche Dichte, was bedeutet, dass man nur einen Teil des möglichen Wiedergabebereichs des Papiers ausnutzt.
Der fundamentale Unterschied zwischen Film und Papier besteht also im Wesentlichen darin, dass man beim Film die maximal mögliche Dichte nicht ausnutzt, sondern den Kontrast über die Entwicklungszeit steuert, während beim Papier auf maximale Dichte hin entwickelt wird und der Kontrast eine vom Hersteller vorgegebene Emulsionseigenschaft ist.
Man hätte das vielleicht auch anders hinbekommen können, vielleicht so, dass auch Filme ausentwickelt würden und dann einen festen, zu den Papieren passenden Kontrast hätten. Das wären dann idiotensichere Film/Papier-Kombinationen. Die Idiotensicherheit würde man sich dann allerdings mit einem Verlust an Beeinflussbarkeit, und damit an künstlerischer Freiheit, erkaufen.
Welche Papiere sind wirklich neutralschwarz (meine bevorzugte Sorte) oder warmschwarz?
Stichworte:
• Bildton
• Warmtonpapier
• Kalttonpapier
• Neutraltonpapier
• Einfluss des Entwicklers auf Bildton
Da ich als armer Amateur nicht alle Papiere ausprobieren kann, müsste ich hier stapelweise Kataloge auswerten, um Ihnen dann doch nur Second-Hand-Informationen aus Herstellerbewertungen zu vermitteln. Das können Sie sicher selbst.
Im Übrigen ist der Bildton eines Papiers nichts Absolutes. Oriental New Seagull G war ein neutraltoniges Papier. Das neue Oriental New Seagull GF wird von Oriental immer noch als neutraltoniges Papier ausgewiesen, ist aber deutlich gelber als das alte, was aber nur bei Vergleichen Seite an Seite auffällt.
Nun gibt es Kalttonentwickler, Neutraltonentwickler und Warmtonentwickler, die die Papiere entsprechend ihrem Namen beeinflussen sollen. So wird ein Warmtonpapier, das man mit einem Warmtonentwickler verarbeitet natürlich deutlich wärmer aussehen als dasselbe Papier mit einem Kalttonentwickler verarbeitet. Aber ob nun ein Warmtonpapier, entwickelt in Kalttonentwickler kälter ist als ein Kalttonpapier in Warmtonentwickler... Richtig kalte Bildtöne liefert auch Goldtoner, wenn man ihn unverdünnt auf Warmtonpapier loslässt; da kann sich sogar Ilford Cooltone nicht mit vergleichen.
Kurz und gut: Der Bildtöne gibt es nahezu unendlich viele. Sie werden nicht darum herumkommen, sich ein paar Proben zu kaufen und damit zu spielen.
Im Trend gilt: Warmtonpapiere wie Ilford MG IV Warm Tone oder Forte Polywarmtone lassen sich durch Toner und Entwickler viel stärker im Bildton beeinflussen als Kalttonpapiere. Diese letztgenannten verändern ihren Bildton i.Allg. nur sehr widerwillig.
Wie kann man moderne PE-Papiere mit dem Entwickler beinflussen?
Verwandte Frage:
Welche (PE-)Papiere lassen sich mit welchen Entwicklern wie beeinflussen, z.B. wie wirkt Neutol WA auf Kodak Polymax, Ilford MGIV, Agfa MCP, Tura?
Stichworte:
• Bildton
• Warmtonpapier
• Kalttonpapier
• Neutraltonpapier
• Einfluss des Entwicklers auf Bildton
• Korngröße und Bildton
Hinsichtlich ihrer Empfänglichkeit für Bildtonabstimmungen mittels spezieller Warm- oder Kalttonentwickler ist es in aller Regel so, dass neutral- und kalttonige Emulsionen, gleich ob auf PE- oder Barytunterlage, nicht besonders enthusiastisch reagieren. Bei PE-Papieren ist es wohl in der Regel auch so, dass selbst dann, wenn der Hersteller dieselbe Emulsion auf den Baryt- und den PE-Träger gießt (z. B. bei Forte Polywarmtone Plus FB und RC oder MACO Expo RF und MACO Lithpaper RC-F) die Schicht auf dem PE-Träger dünner ist. Das liegt nicht am Geiz der Hersteller, sondern ist eine sich aus der Produktionsweise ergebende Notwendigkeit.
Der Unterschied in den Bildtönen liegt in der Korngröße der Silberteilchen begründet: Feine Körnchen ergeben warme Bilder, grobe Körnchen ergeben kalte. Bei gleicher Masse an Bildsilber haben also die Silberkörnchen in warmtonigen Bildern viel mehr Oberfläche, die von Chemikalien, z.B. Tonern, aber auch aggressiven Umweltchemikalien, angegriffen werden kann. Mehr Angriffsfläche bedeutet auch mehr Einflussmöglichkeit.
Wie lange lässt man Fotopapier abtropfen, bevor man es in die nächste Schale überführt?
Stichworte:
• Abtropfzeit
• Verschleppung
Das Problem wird in Haists Modern Photographic Processing im Zusammenhang mit der Zweibadfixage diskutiert. Dort werden zur Verringerung der Verschleppung von Bad 1 nach Bad 2 eine Abtropfzeit von mindestens 5 s, vorzugsweise länger, angeraten. Aus meiner Sicht sind 10 s einerseits nicht zu lang und andererseits hinreichend.
Sie müssen im Übrigen nicht jegliche Verschleppung verhindern. Es macht z.B. nichts, wenn Sie ein bisschen Entwickler ins Stoppbad verschleppen. Das Stoppbad ist im Gegenteil gerade dazu da, diese Reste unwirksam zu machen. Beim Lith-Verfahren z.B., wo man nicht ausentwickelt, ist es unbedingt erforderlich, das Bild ohne jede Pause gleich ins Stoppbad zu schieben, da man sonst den Abbruchpunkt verpasst und die Schatten zulaufen könnten bzw. die Entwicklung ungleichmäßig werden könnte.
Wie lange muss ich Fotopapier fixieren?
Stichworte:
• Fixierzeit
• Klärzeitmessung
• Zweibad-Fixage
Ich mache es mir einfach: Verfahren Sie wie bei Filmen und führen Sie eine Klärzeitmessung durch!
Gut, ich sehe, Sie halten mich jetzt für bekloppt. Klärzeitmessung bei Papier? Geht nicht, da man durch Papier nicht gucken kann. Doch. Geht wirklich. Habe ich jedenfalls gelesen. Fixieren Sie Papierstücke für unterschiedliche Zeiten und notieren Sie auf jedem Stück die Fixierzeit. Natürlich sehen alle weiß aus. Aber jetzt kommt der Trick: Sie können recht einfach feststellen, ob noch Silberhalogenid drin ist, indem Sie das (teil-)fixierte Bild mit einem Tropfen Natriumsulfid-Lösung (z.B. stinkende Schwefeltoner-Lösung) behandeln. Selbst kleine Mengen Silberhalogenid zeigen sich durch eine Braunfärbung. Das Stückchen, welches als erstes keinen gelblich-braunen Fleck mehr aufweist, ist „geklärt“. Multiplizeren Sie diese Zeit mit 2, und Sie haben Ihre Fixierzeit. So einfach ist das.
Im Prinzip.
Bei Film schreibe ich mir seit Jahren die Finger wund mit dem Hinweis, man solle vor jedem Gebrauch des Fixierbades die Klärzeit bestimmen und die Suppe entsorgen, wenn die Klärzeit für eine gegebene Filmsorte doppelt so lang ist wie mit frischem Bad, denn die Klärzeit verändert sich mit jedem behandelten Film. Selbst wenn man nicht vor jedem einzelnen Bild die „Klärzeit“ nach obigem Verfahren bestimmt, sondern nur vor jeder Duka-Session, ist das schon ein unangenehmer Aufwand. Da macht es m.E. mehr Sinn, mit Silberprüfstreifen den Silbergehalt des gebrauchten Bades zu bestimmen und es ab einem bestimmten Grenzwert (s. Tabelle in Fixierbad) das Bad zu verwerfen.
Verwenden Sie das Zweibad-Verfahren (noch so etwas, das ich aus purer Verbohrtheit seit Jahrzehnten predige), so sind Sie fein raus. Wenn Sie den Silbergehalt von Bad 2 regelmäßig messen, werden Sie feststellen, dass es praktisch arbeitslos ist. Wenn mein Bad 1 2 g Silber je Liter Bad enthält, ist Bad 2 noch völlig jungfäulich. Ich kann also ziemlich sicher sein, dass meine Fixage ausreichend ist, da die Bilder offenbar schon nach Bad 1 sehr weitgehend fixiert sind. Wenn Sie also beim Zweibad-Verfahren nach ein Paar, sagen wir: 10, Bildern feststellen, dass Ihr Bad 2 nennenswerte Silbergehalte aufweist, ist die Fixierzeit zu kurz!
Wozu dient Stoppbad beim Verarbeiten von Prints?
Stichworte:
• Stoppbad
• Fixierbad
• Verschleppung
Es erfüllt im Wesentlichen zwei Zwecke: Erstens bricht es die Entwicklung relativ schnell ab und verhindert ein Nachentwickeln zwischen Entwickler und Fixierbad sowie die Ausbildung eines dichroitischen Schleiers im Fixierbad.
Praktisch alle Entwicklersubstanzen arbeiten nur im Alkalischen, d.h. sie stellen, selbst wenn sie „unverbraucht“ vorliegen, im sauren Milieu sofort ihre Tätigkeit ein.
Beim konventionellen Vergrößern (im Unterschied zum Lith-Verfahren) wird das Papier ausentwickelt, d.h. es wird so lange entwickelt, dass sich „nichts mehr tut“, d.h. dass ein paar Sekunden mehr oder weniger auch nichts mehr am Bild ändern würden (s. auch Frage der Entwicklungszeit). Das ist bei Papieren notwendig, weil man nur durch Ausentwickeln auch wirklich die maximal mögliche Dichte und den bestmöglichen Schattenkontrast bekommt. (Ein zu kurz entwickeltes Bild sieht in aller Regel schmutzig und verwaschen aus.) Unter diesem Aspekt wäre ein Stoppbad eigentlich überflüssig, denn wenn das Papier „ausentwickelt“ ist, kann ihm auch in einem Wasserbad zwischen Entwickler und Fixierbad nichts mehr passieren. Das Bisschen verschleppter Entwickler würde sich schnell verbrauchen und verdünnen, und das war’s.
Leider kann es aber im Fixierbad zu einer Nachentwicklung kommen, wenn der pH-Wert noch so hoch ist, dass die Entwicklersubstanz noch aktiv bleiben kann. Dann werden unbelichtete Silberhalogenide gleichzeitig mit der Auflösung durch das Fixierbad durch verschleppten Entwickler entwickelt. Sie führen dann nicht zu einer bildmäßigen Schwärzung, sondern, da die Entwicklung während des Abtransports passiert, zu einem unangenehmen delokalisierten Schleier. Anfällig sind hierfür insbesondere neutrale und alkalische Fixierbäder. Bei solchen sollte man unbedingt ein Stoppbad verwenden.
Sie könnten jetzt auf den Gedanken kommen, dass man doch einfach ein saures Fixierbad benutzen sollte. Welche Vorteile ein neutrales Bad hat, darüber bereite ich derzeit eine Kolumne vor.
Was ist die optimale (oder mach?/bezahlbare) Wässerung?
Stichworte:
• Wasserverbrauch
• Energieverbrauch
• Zeit
• Kaskadenwässerung
Gegenfrage: von welchem Standpunkt aus betrachtet? Die optimale Wässerung mit dem geringstmöglichen Wasser- und Energieverbrauch ist diestehende Kaskadenwässerung. Bringen Sie das Bild in eine Schale mit so viel Wasser auf Raumtemperatur, wie Sie benötigen, um es gut zu bedecken und schwimmen zu lassen. Lassen Sie es n Minuten unter gelegentlicher Bewegung schwimmen. Dann wechseln Sie das Wasser. Diesen Vorgang wiederholen Sie m Mal. n ist 1 für PE-Papier und 5 für Barytpapier, m = 5 für PE und 10 für Baryt. (Also für PE: 5 Wasserwechsel mit je 1 min Einwirkzeit.)
Dieses Wässerungsverfahren gibt Ihnen Bilder, wie Sie sie besser nicht auswässern können, aber es frisst viel Zeit. (Und nicht einfach Zeit, während der Sie Schlafen gehen können. Sie müssen ja immer mal wieder rühren und Wasser wechseln.)
Daher verweise ich Sie dann doch lieber auf meinen Artikel von Dezember 2000 "Lange Wässern hilft nicht - kurz fixieren hilft!“ bzw. auf einen in Vorbereitung befindlichen Artikel, in dem ich untersuchen möchte, wie sich saures und neutrales Fixierbad hinsichtlich der Auswässerung verhalten.
Muss man dicke Papiere länger wässern?
Stichworte:
• Wässerung
• Papierstärke
Ich hatte oben bereits darauf hingewiesen, dass dickes Papier „durstiger“ ist als dünnes. Dennoch ist mir in der Fachliteratur bisher kein Hinweis untergekommen, dass man dicke Papiere länger oder dünne kürzer wässern sollte. Man würde es intuitiv erwarten, doch ich kann es nicht belegen. Angesichts der Geschichte der Fotografie, in der es einmal ein Expertengremium gab, das Fixierbadreste als die Quelle des Verfalls von Fotos schlechthin ausgemacht hatte, liegt die Vermutung nahe, dass die Wässerungsempfehlungen der Hersteller sämtlich auf der sicheren Seite liegen.
Wie wirken sich die Wässerungstemperatur und -dauer auf den Farbton aus? (kühler/wärmer)
Stichworte:
• Wässerung
• Bildton
Streng genommen sollte sie sich nicht auf den Bildton auswirken. Ich meine mich aber zu erinnern, dass z.B. in einem Ilford-Datenblatt zu Barytpapier von einer Beeinflussbarkeit des Bildtons durch die Wässerungsdauer gesprochen wird. Dort hieß es nach meiner Erinnerung, dass langes Wässern den Bildton wärmer mache.
Wie an anderer Stelle erwähnt, hängt der Bildton primär von der Silberteilchengröße ab, und die lässt sich m.W. durch die Wässerung nicht beeinflussen. Was aber passieren kann, ist dass ein evtl. vorhandener optischer Aufheller ausgewaschen wird. Optischer Aufheller auf der anderen Seite (siehe an anderer Stelle in diesem FAQ) lässt das Bildweiß in kühlem Blau erstrahlen. Fällt das weg, könnte ich mir vorstellen, dass der Bildton wärmer erscheint. Ansonsten ist mir nicht klar, wie zu einem Effekt kommen sollte.
Viele Papierhersteller werben mit der besonders hohen Schwärzung, die die Papiere erreichen. Gibt es wirklich Unterschiede, die mit dem Auge wahrnehmbar sind?
Stichworte:
• Maximaldichte
• Maximalschwärzung
• Sichtbarkeit von Dichtedifferenzen
• Papieroberflächen
• Optische Aufheller
Ja, die gibt es. Aber: Nein, es ist nicht so, dass nur das Papier mit der höchsten Maximaldichte das beste sein kann.
Die Spanne zwischen Weiß und Schwarz, die ein Papier wiedergeben kann, wird durch die beiden Werte Dmin und Dmax begrenzt.
Dmin ist das weißeste Weiß, und man würde erwarten, dass Papier nicht mehr als 100 % des einfallenden Lichts reflektieren kann. Stimmt auch, aber Papier kann selber „leuchten“, oder genauer: fluoreszieren. M.W. sind praktisch allen heute verfügbaren Papieren optische Aufheller zugesetzt. Das sind Chemikalien, die langwellige ultraviolette (UV) Strahlung – die unsichtbar ist – absorbieren und die aufgenommene Energie als sichtbares bläuliches Licht wieder abgeben. Dadurch kann ein Papier mehr sichtbares Licht abgeben als auftrifft. Das Weiß das Papiers wirkt dadurch „weißer“. Allerdings tritt der Effekt beleuchtungsabhängig auf: Fällt keine UV-Strahlung auf das Papier, so fluoreszieren auch die Aufheller nicht. Das ist z.B. bei ordinärer Glühlampenbeleuchtung weitgehend der Fall. Übermäßig langes Wässern soll auch dazu führen können, dass die Aufheller ausgewaschen werden.
Die Frage, ob die Wirkung der Aufheller im Laufe der Zeit nachlässt, scheint noch niemand bisher ernsthaft untersucht zu haben, aber ich würde es vermuten. Schließlich handelt es sich bei den Aufhellern um organische Farbstoffe, die ultraviolettes Licht absorbieren. Allerdings muss das nichts Schlimmes heißen. Gutes Papier ist von sich aus schon recht weiß. So lange das Papier nicht vergilbt, macht es nicht viel, wenn die Aufheller an Wirkung verlieren. Das Weiß mag ein bisschen weniger nach „Weißer Riese“ aussehen, aber immer noch weiß.
Aber die Frage galt dem schwärzesten Schwarz, dem Dmax. Dieser Wert hängt sehr stark von der Papieroberfläche ab. Die größten Werte haben glänzende Papiere.
|
|
Warum ist das so? Dazu muss man wissen, wie Papier angeschaut und densitometrisch vermessen wird. Eine Messzelle misst senkrecht zur Papieroberfläche, wie viel Licht vom Papier zurückgeworfen wird, wenn es durch zwei Messlampen unter einem Winkel von 45° beleuchtet wird. (Gezeichnet ist nur das Messlicht von rechts, sonst würde das Bild zu unübersichtlich.) An einer ungeschwärzten Stelle des Papiers trifft das Messlicht den weißen Papierträger, von dem es diffus gestreut wird. Wie viel Licht dann die Messzelle erreicht, hängt davon ab, wie weiß der Träger ist. An einer Stelle, wo die Silberschicht vollständig geschwärzt ist, schluckt nun die aus fein verteilten Silberkörnchen bestehende Bildschicht alles Licht, und es kann nur das Licht zur Messzelle reflektiert werden, das von der Papieroberfläche reflektiert wird. Glänzendes Papier hat eine „spiegelglatte“ Oberfläche, d.h., dass einfallende Lichtstrahlen nach dem Gesetz „Einfallswinkel = Ausfallswinkel“ reflektiert werden. Von dem unter 45° auf die Oberfläche fallenden Licht wird idealerweise nichts zur Messzelle reflektiert. Schwärzer geht’s nicht. |
Anders bei mattem Papier. Bei mattem Papier – das ist gerade die Definition von „matt“ – wird Licht nicht scharf und gerichtet reflektiert, sondern diffus. Das bedeutet, dass ein Lichtstrahl, der das Papier an einer Stelle trifft, nicht ausschließlich nach dem oben zitierten Reflexionsgesetz reflektiert wird, sondern bei ideal mattem Papier gleichmäßig in alle Richtungen. „Halbmattes“ Paper ist ein Zwischending. Hier wird der Lichtstrahl zwar noch bevorzugt nach dem Reflexionsgesetzt reflektiert, aber es wird auch viel in die anderen Richtungen gestreut. Bei der Messung einer weißen Stelle passiert im Wesentlichen dasselbe wie bei glänzendem Papier, s.o. Mattes Papier kann also genau so weiß sein wie glänzendes. Aber bei einer schwarzen Stelle merkt man den Unterschied: Jetzt wird nämlich ein nennenswerter Anteil des Messlichts in die Messzelle gestreut. Wenn aber mehr Licht in die Messzelle gestreut wird als bei glänzendem Papier, heißt dass, dass das matte Papier weniger „schwarz“ ist als das glänzende.
Wenn nach dem eingangs Gesagten Dmin und Dmax die Grenzen der auf dem Papier erzeugbaren Tonwerte sind, heißt dies, dass glänzendes Papier immer einen größeren Umfang zwischen diesen Eckwerten wird wiedergeben können als mattes. Macht das das glänzende Papier „besser“? Ansel Adams benutzte immer glänzendes Papier, allerdings – so beeilte er sich zu versichern – nicht, weil er es „besser“ fand, sondern weil er aus „geschmäcklerlischen“ Gründen den maximal möglichen Bereich nutzen wollte.
Er benutzte aus demselben Grund immer neutral schwarzes Papier. Neutral schwarzes Papier schluckt alle Farben, deswegen ist es ja gerade schwarz. Wenn aber ein Papier nicht neutral schwarz ist, wirft es Licht in einer Farbe zurück, z.B. rötliches bei einem warmtonigen Bild, braunes bei einem schwefelgetonten oder bläuliches bei blaugetontem. Damit wird aber mehr Licht zurückgeworfen als bei neutral schwarzem Bildton, und die Spanne wird kleiner.
Nach diesem langen Ausflug in die Densitometrie kehren wir zur Ursprungsfrage zurück: Bringt es ein extrem hoher Dmax? Aus meiner Sicht nicht. Warum nicht? In seinem mittlerweile legendären (und daher nur noch für horrende Preise zu erwerbenden) Buch Controls in Black-and-White Photography legt Richard Henry zwei Dinge dar:
1. Je stärker die Schwärzung, desto größer muss der Schwärzungsunterschied sein, damit man ihn sehen kann.
Klartext: Einen Dichteunterschied zwischen 0,05 und 0,06, also von 0,01 am „weißen“ Ende der Skala, 0,05, 5 Mal so viel am „schwarzen“ Ende der Skala sehen viele, selbst geübte Betrachter nicht oder nur unter sehr günstigen Lichtverhältnissen.
2. Die theoretisch möglichen Maximaldichten werden in normalen Abzügen meist nicht erreicht, da die für die richtige Wiedergabe der Mittel- und Schattentöne nötigen Belichtungen oft nicht ausreichen, um selbst an einer völlig klaren Negativstelle maximales Schwarz zu erzielen.
Henry belegt das durch Messungen an „First Choice Prints“, u.a. von Ansel Adams und Brett Weston, die nach seinen Ergebnissen unter den maximal möglichen Werten blieben.
Was uns zwanglos zur nächsten Frage bringt:
Bei Selentoner wird mit einer Erhöhung der Maximaldichte geworben. Ist das empfehlenswert?
Stichworte:
• Maximaldichte
• Schattendifferenzierung
• Bildton
• Luftperspektive
• Goldtoner
Also ich finde Selentoner klasse. Aber nicht weil er die Maximaldichte erhöht, sondern als Toner. Dass eine weitere Erhöhung der Maximaldichte nicht unbegrenzt Sinn macht, ist nach dem zuvor Gesagten klar. Aber das ist auch nicht das Einzige, was Selentoner vollbringt. Er beeinflusst nämlich den Schattenkontrast und den Bildton, und das ist mir wichtiger.
Eine Anhebung des Schattenkontrasts bringt mir genau das, was ich nach dem oben Gesagten brauche, nämlich stärkere Differenzierung in den hohen Dichten, größere Dichteunterschiede bei den hohen Dichten.
Die Veränderung des Bildtons ist unterschiedlich: Bei stark verdünntem Selentoner (1+20 und dünner), nicht zu lange angewendet (2 bis max. 3 min), merkt man meist nicht viel von einem Farbton. Wohl aber bei höheren Konzentrationen (1+9 und höher) und bei längeren Einwirkzeiten (3 min und mehr). Bei dieser Anwendung fängt der Bildton an, nach Warmbraun bis Aubergine umzuschlagen, und – das ist der Effekt, den ich persönlich liebe – beginnend in den Schatten. Sie können in dieser Weise ein Bild in den Schatten rötlich antonen, dann die Tonung abbrechen und es z.B. mit Goldtoner weiter behandeln. Goldtoner führt zu einer Blauverschiebung des Bildtons, bei an sich warmtonigen Papieren mehr als bei neutralen oder kalttonigen. Der Effekt ist ein faszinierender: Die Schatten sind rötlich getont, die Lichter leicht bläulich. Machen Sie das mal mit einem Landschaftsfoto: Landschaftaufnahmen haben es oft an sich, dass der Vordergrund dunkel ist und aufgrund der Luftperspektive die Grauwerte mit zunehmender Entfernung immer heller werden. Wenn Sie die Landschaft mit dem Auge beobachten werden Sie sehen, dass tatsächlich auch die Farben zum Horizont hin immer blauer werden, eine Auswirkung der Streuung des Lichts in der Atmosphäre, eben der so genannten Luftperspektive. Ein so zunächst in Selen, dann in Gold getontes Bild (Umgekehrt klappt es nicht, da das Selen die Wirkung des Goldtoners aufhebt.) wirkt durch Nachbildung des natürlichen visuellen Eindrucks äußerst plastisch.
Ist die Tonung mit Selen gerechtfertigt (Preis/Umweltschutz)?
Stichworte:
• Wirkung von Selentoner
• Maximaldichte
• Schattendifferenzierung
• Bildton
• Bildhaltbarkeit
• Umweltschutz
• Problemstoffentsorgung
Was heißt schon gerechtfertigt? Die Antwort auf die Frage hängt von Ihrer persönlichen Bewertung ab. Ich kann Ihnen nur ein paar Kriterien liefern, bewerten müssen Sie diese aber selbst.
Fangen wir mit dem Preis an: Selentoner ist nicht extrem teuer. Der Aufwand ist also gering. Was aber ist der Nutzen? Da sind aufzuzählen:
(1) Erhöhung der Maximaldichte (siehe aber auch Ausführungen zu hohen Dichtewerten)
(2) Verbesserung der Bildhaltbarkeit (nur bei Tonung bis zur Bildtonänderung)
(3) Veränderung des Bildtons (siehe auch oben)
Speziell Aspekt (3) ist keiner allgemeinen Bewertung zugänglich. Der eine mag’s und will nicht drauf verzichten, der andere nicht. Wenn man diesen Aspekt nun gegen Preis oder Umweltschutz aufwiegt, kann man auch gleich fragen, ob die ganze Fotografie unter Umweltgesichtspunkten überhaupt vertretbar ist, denn um ein Bild zu erzeugen
• verbrauchen wir Unmengen an Trinkwasser,
• verwenden wir teilweise recht problematische Chemikalien (nicht nur Selentoner),
• verbrauchen wir ein giftiges Schwermetall (Silber ist ein solches!), das wir teilweise freisetzen, usw. usf.
Aber viele andere Hobbies sehen auch nicht besser aus, sei es das Skifahren in den Alpen, das Wandern in der freien Natur, für das manche von uns am Wochenende viel Sprit verfahren, um erst einmal in die Natur zu kommen usw. Also: Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich kann Ihnen zum Thema Umweltschutz nur empfehlen
• Ihre Abwässer fachgerecht, d.h. per Schadstoffsammlung zu entsorgen, nicht über den Gulli,
• nur die Chemikalien zu verwenden, von denen Sie sicher sind, dass Sie sie brauchen,
• immer auf der Suche nach möglichst unproblematischen Ersatzstoffen zu sein (z.B. Vitamin-C-Entwickler wie beim Papier Agfa Neutol Plus oder Amaloco AM8008 Ecomax statt Hydrochinon-Entwicklern und bei Filmen – leider immer noch mit Resten an problematischeren Stoffen – Xtol und Ilfosol S).
So bleibt das Gewissen wenigstens halbwegs rein (und die Umwelt auch).
Nützlich fände ich eine tabellarische Aufstellung der bei uns erhältlichen Papier (ich rede jetzt mal nur von Baryt), wobei mich speziell interessiert, welche Papiere mit eingelagerten Entwicklern ausgerüstet sind und welche nicht.
Stichworte:
• Eingelagerter Entwickler
• Test
• Lith-Verfahren
Sorry, das sprengt meinen Rahmen. Dazu müsste ich Mails an alle Hersteller loslassen und auswerten.
Ein paar Dinge habe ich im Laufe der Zeit gelesen: So weiß ich z.B. dass Ilford seinen Papieren zur Verbesserung der Haltbarkeit geringe Mengen der Entwicklersubstanz Phenidon zusetzt, und auch Agfa verwendet m.W. solche Zusätze. Von Forte, Oriental und MACO EXPO auf der anderen Seite weiß ich aus meinen Erfahrungen mit dem Lith-Verfahren, dass sie keine Entwicklersubstanzen enthalten.
Sie können aber jedes Papier leicht auf enthaltenen Entwickler testen: Nehmen Sie ein Stück des fraglichen Papiers und setzen Sie es kurz dem Tageslicht aus. Geben Sie dann einen Tropfen Natronlauge darauf. Das Alkali aktiviert die Entwicklersubstanz. Papiere mit eingelagertem Entwickler werden daher sofort einen Fleck bilden.
Mich würde interessieren, wie hoch der Silber Anteil in Baryt und PE ist, und ob man darüber einen Rückschluss auf die Qualität bzw. die max. Schwärzung ziehen kann.
Stichworte:
• Silbergehalt
• Maximalschwärzung
• Papierqualität
Nach meiner Kenntnis der Herstellung und Beschichtung von Fotopapier ist selbst dann, wenn für eine Baryt- und eine PE-Papiersorte dieselbe Emulsion verwendet wird, die PE-Emulsion i.d.R. dünner, was bedeutet, dass je Flächeneinheit Papier weniger Silber enthalten ist.
Aber: Richard Henry hat die Fleißarbeit geleistet zu untersuchen, ob der Silbergehalt mit der Maximaldichte korreliert ist. In seinem Buch Controls in Black-and-White Photography dokumentiert er die Ergebnisse und kommt zu der klaren Aussage, dass höherer Silbergehalt nicht gleichbedeutend mit höherer Schwärzung ist.
Wie bitte? Wie viel soll das kosten?
Wieder vorneweg: Nachträge zu den "Tipps und Tricks"
Thomas Wollstein
Februar 2004
Ich freue mich, dass doch der eine oder andere Leser sich die Zeit genommen hat, Kontakt mit mir aufzunehmen und mir auch seine Tipps mitzuteilen, auf dass mehr Leute von guten Ideen profitieren können. Daher auch in dieser Kolumne wieder ein paar Nachträge und meine Bitte, nicht damit hinter dem Berg zu halten, wenn Sie gute Ideen haben, die vielleicht auch anderen helfen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich alles veröffentliche, was kommt, aber ich bin guten Willens.
Zum Stichwort "Sauberes Negativ" schrieb mir Herr Oliver Ulrich:
Thema: Wie bekomme ich ein sauberes Negativ / eine saubere Bildbühne?
Antwort: Mit dem "Kamelhaarpinsel Delta 1"!
Das Ding ist zwar teuer, aber bei mir funktionierts!
Link: http://www.fotoimpex.de
Ich muss gestehen, dass meine eigenen Erfahrungen mit Pinseln aller Art nicht besonders positiv waren, da die meisten Pinsel im Laufe der Zeit Schmier ansammelten, der Spuren auf dem Negativ hinterließ. Auch dem kann man natürlich durch regelmäßige Reinigung mit einem Lösungsmittel entgegenwirken. Den positiven Erfahrungsbericht wollte ich Ihnen jedoch nicht vorenthalten.
Merkwürdiger Zufall: Noch ein Herr Ulrich, diesmal Olaf Ulrich, schrieb zum Thema "Duka lichtdicht machen":
Ein billiges und in (fast) jedem Haushalt vorhandenes, absolut lichtdichtes Material ist Haushalts-Aluminiumfolie. Um ein Fenster abzudichten, bastele man sich aus Zeitungspapier und Klebefilm einen papiernen Träger in passender Größe (am besten mehrlagig für bessere Festigkeit) und kaschiere diesen dann mit einer Lage Aluminiumfolie. Einfacher, lichtdichter und billiger geht's nicht.
Statt Zeitungspapier kann man natürlich auch einen großen Pappkarton o. dgl. nehmen...
Auch dazu noch etwas von mir: Eine flexible Verdunklung aus Alu-Folie dürfte nicht praktikabel sein, da die Folie zu schnell brechen würde. Aber eine entfernbare Verdunklung mit folienkaschierten Pappen klingt gut.
Aber es gibt noch weitere Materialien, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte:
Herr Ulrich hat mich an meine Diplom-Arbeit in der Festkörperspektroskopie erinnert. Mein dortiges Labor, vollgestopft mit Gerätschaften, die auf Temperaturschwankungen mit Dejustierung reagierten, hatte riesige Fensterflächen und lag – natürlich – nach Süden. Da wir ohnedies immer im Dunkeln messen mussten und die Wärme auch nicht gebrauchen konnten, haben wir damals kurzerhand alle Fenster mit selbstklebender Alu-Folie verklebt. Einfacher als von Herrn Ulrich beschrieben, geht also vielleicht, aber das Zeug war natürlich recht teuer, aber es war ja eine dauerhafte Angelegenheit.
Eine preiswertere, begrenzt flexible Verdunklung kann man sich aus den im Baumarkt erhältlichen Rollen Alu-kaschierten Hartschaums basteln. Dieses Material ist als Wärmedämmstoff und Strahlungsreflektor hinter Heizkörpern gedacht. Es ist nicht besonders teuer und erspart es einem, sich selber damit herumärgern zu müssen, dünne, je nach Marke extrem reißfreudige Folie auf einen Träger kleben zu müssen.
Zu guter Letzt Herr Stefan Schmitz:
Ich gehöre noch zu den Menschen, die Ihre Abzüge (meist PE) auf der Leine trocknen. Da die Leine in der Dunkelkammer hängt, stoße ich manchmal dagegen. So ist es schon mal passiert, dass der ein oder andere Abzug "zu Boden ging" und natürlich danach unbrauchbar war.
Jetzt bin ich durch Zufall auf eine Lösung gestoßen (das ist jetzt ernst gemeint!): Kleiderbügel für Hosen. Ich meine die, wo an einer waagerechten Stange zwei verschiebbare, gummierte Klammern befestigt sind. Die halten echt bombenfest, und weil sie verschiebbar sind, passen sie auf viele Formate, und man kann sie so schieben, dass immer eine Ecke des Abzugs zum Abtropfen tiefer hängt. Das beste aber ist, dass die Dinger ja nichts kosten. Einfach im Laden fragen!
Ob das Gummi das Papier "angreift" weiß ich natürlich nicht, aber da ich fast ausschließlich mit Rand vergrößere, dürfte das nicht das Problem sein.
Die Druckstellen sieht man tatsächlich nach dem Trocknen. Aber gerade PE-Papier sollte man sowieso mit Rand vergrößern und hinterher zuschneiden, denn in die Schneidkanten dringt immer Chemie ein, die auch nach längerem Wässern nicht wieder heraus bekommt, denn PE-Papier wird Dank der PE-Laminierung nicht gut vom Wasser durchdrungen. (Und wirklich langes Wässern ist für PE-Papier nicht gut; es kann sich die Laminierung lösen.) Irgendwann fangen die eindiffundierten Substanzen dann an zu oxidieren und sich zu verfärben. Bei Baryt ist das kein Problem, da es keine Sperrschichten hat und folglich vollkommen durchweicht, aber auch wieder vollkommen durchwässert wird.
Ich selber verwende zum Trocknen von PE-Bildern Wäscheklammern, die ich mit einem Haken aus Blumendraht versehen habe. (Einfach einen hinreichend langen, dünnen Blumendraht durch die Feder schieben und S-förmig verbiegen.) Mit dem Haken hänge ich das Bild dann an eine Leine o.ä. Für alles außer großen Formaten reicht eine Klammer, und die Bilder hängen, an nur einer Ecke aufgehängt, immer schräg. Nehmen Sie Holz-Wäscheklammern, denn die Plastikdinger halten a) wegen des glatten, zahnlosen Mauls und b) weil sie oft nicht richtig schließen, nicht so sicher. Bei großen Bildern, ab 30 x 40 cm, empfehlen sich zwei Klammern, damit nicht durch das Gewicht des Bildes ein Knick oder gar Abriss auftritt. Wenn das Bild dann nicht schräg hängt, ist das auch kein Problem, denn sollten sich Trockenränder bilden, liegen die auch im Randbereich, und der wird wie erwähnt abgeschnitten.
Baryt auf der Leine zu trocknen halte ich für keine gute Idee. Dadurch, dass das Papier unter ungleichmäßiger Spannung trocknet, verzieht es sich mitunter so unangenehm, dass es fast nicht mehr glatt zu bekommen ist. Bei Baryt empfehle ich Ihnen die Vortrocknung (vor Retusche usw.) liegend auf einem Tuch und die endgültige Trocknung aufgespannt. Dazu vielleicht später mehr. Vielleicht kann ich ja einen alten Meister überreden, für diese Kolumne darzustellen, wie er seine großen Baryt-Prints glatt kriegt.
Aber jetzt zum Thema dieses Monats:
Zu Anfang: eine biographische Geschichte
Vor einigen Jahren bestritt die Ballettschule, in der meine Tochter regelmäßig übt, eine Aufführung im Rahmen des Düsseldorfer Altstadtherbstes. Als liebender Papa wollte ich mir das natürlich nicht entgehen lassen, und als SW-Fotograf reizte mich das Thema zudem. Also schoss ich während der Vorstellung eine Menge Bilder. Andere Eltern, die das mitbekommen hatten, baten mich, die Fotos doch herumzuzeigen und wollten hernach natürlich Abzüge. („Hach, das sind aber tolle Bilder!“ Und: „Ich finde für Ballett Schwarzweiß sowieso schöner als bunt.“) So weit so gut. Ich setzte also einen Preis fest, von dem ich dachte, dass er hinreichend hoch sei, um die Anzahl der Nachbestellungen nicht zu groß werden zu lassen. Schließlich musste ich alles in Handarbeit erledigen. Jeder Abzug war ein Handabzug, der teilweise erheblichen Aufwand an Nachbelichtung und Abhalterei erforderte. Bühnenlicht ist schließlich nicht das einfachste. Von Retusche wollen wir mal gar nicht reden.
Sie ahnen, was passierte? Trotz des Preises bestellten die Eltern wie wild. 120 Kinder hatten an der Aufführung teilgenommen, und so musste ich eine Menge Abzüge in „Fließbandarbeit“ erstellen. Es kam mir zugute, dass ich alle Abzüge auf demselben Papier angefertigt hatte und immer detailliert notiert hatte wo mit welcher Gradation und wie lange nachzubelichten war. Dennoch war das Ganze eine ganz und gar unerquickliche Erfahrung. Tage (oder, da ich einen normalen Bürojob habe und die Duka nur Hobby ist, eher Nächte) in der Duka nur mit Sklavenarbeit! Der Preis für einen Abzug war ganz offensichtlich zu gering gewählt, denn trotz der unerwartet hohen Einnahmen konnte ich das Ganze doch nicht als ausreichende Entschädigung für die öde Schufterei in der Duka empfinden. War eben keine wirkliche Vollkostenrechnung, denn in die wäre neben dem Material auch die Zeit mit eingeflossen.
Bei derselben Aufführung war noch jemand mit Kamera zugegen. Die Dame (Unterstellen Sie mir bitte keinen Chauvinismus; ich kann nichts dafür, dass es eine Dame war!), deren Namen ein Fotogeschäft in teurer Lage in unserer Stadt ziert, hat in irgendeinem fotografischen Beruf eine Lehre absolviert, aber die Fotos, in Farbe und mit einem vollautomatischen Knipskasten mit eingebautem Blitz nach Maschinengewehrart aufgenommen und im 1-Stunden-Labor vergrößert, waren aus meiner Sicht technisch und ästhetisch von so erbärmlicher Qualität, dass ich sie niemandem gezeigt hätte. Dennoch kauften die Eltern auch diese Bilder wie wild. Die Kriterien sind eben bei liebenden Eltern andere als bei Fotografen. Und was die Diskussion um irgendwelche Berufsbezeichnungen betrifft... Lassen wir das lieber!
Die Schlussfolgerung der ganzen Geschichte ist für mich die: Wenn man als Einzelkämpfer irgendwo fotografiert und die Gefahr besteht, dass eine größere Zahl von händisch zu fertigenden Abzügen nötig wird, sollte man sich gut überlegen, ob man das leisten kann und will. In aller Regel lohnt es den Aufwand nicht, wenn man „zivile“ Preise für seine Fotos nehmen will.
Nur zur Sicherheit: Ich wäre nicht so vermessen, meine Prints von der damaligen Vorstellung als Master Prints zu bezeichnen. Aber dennoch zurück zur eingangs gestellten Frage: Wie teuer kann denn so ein Master Print werden?
Was ist denn überhaupt ein Master Print?
Ich will mich mal an einer Definition versuchen:
Ein Master Print ist ein qualitativ hochwertig verarbeitetes Foto.
Jeder Satz mehr bringt mehr Probleme. Schon diese Definition selbst enthält deren eine Vielzahl. Es ist viel leichter, nach Art eines Zen-Mönchs zu definieren, was man nicht meint, als zu präzisieren, was man meint. „Qualitativ hochwertig verarbeitet“
(1) heißt für mich nicht zwingend, dass es ein Barytprint sein muss, oder
(2) dass es ein analoger Print sein muss.
(3) Gute Aufnahmequalität (Schärfe, richtige Belichtung usw.) kann man auch nicht zum übergeordneten Kriterium machen,
(4) mit inhaltlicher Ästhetik hat sie rein gar nichts zu tun.
Zu (1): Die Geschworenen sind sich nach wie vor noch nicht einig, ob Barytprints nun stabiler sind als PE-Prints oder doch nicht. Barytprints können nachweislich 100 Jahre alt werden, das zeigen genug existierende alte Fotos. PE-Papier hat es vor 100 Jahren noch nicht gegeben.
Tatsache ist aber auch, dass Verarbeitung von Barytpapier bietet mehr Spielraum für Fehler bietet als die von PE-Papier. Die frühen PE-Papiere zerfielen durch Versprödung der PE-Versiegelung, durch Gilb, der dadurch zu Stande kam, dass in die Emulsion eingelagerte Entwickleragenzien durch die Versiegelung hindurch in den Träger diffundierten und dort oxidiert wurden u.a.m. Die modernen PE-Papiere sind nach den übereinstimmenden Aussagen der Hersteller mindestens ebenso archivtauglich wie Barytpapiere. Diese Aussage basiert auf Erfahrungen und auf so genannten Schnellalterungstests. Solche Tests haben aber immer eine Kinke: Wenn die zu Grunde liegenden Annahmen über den Alterungsmechanismus nicht zutreffen, sind die Resultate nicht aussagekräftig. Das heißt im Klartext: Wenn die Chemiker einen möglichen chemischen Mechanismus der Papieralterung nicht gesehen haben, der vom Test nicht berührt wird, kann es sein, dass das Papier trotz toller Resultate beim Schnellalterungstest in 20 Jahren zerkrümelt.
Schweifen wir kurz ab, um ein Beispiel zu geben: Als einen schädigenden Einfluss auf die Tinten von Tintenstrahldruckern hat man z.B. Licht ausgemacht. Da nun ein Konzern wie Epson nicht einfach ein Bild in einem gut beleuchteten Raum an die Wand hängen 100 Jahre warten kann, bevor er einen Tinte auf den Markt bringt, der er eine Lichtbeständigkeit von 100 Jahre attestiert, verfährt man in aller Regel nach dem Motto „Viel hilft viel“ und setzt Probeprints extrem hellem Licht aus. Grob vereinfacht geht man dann davon z.B. aus, dass der Print bei „normalem“ Licht 100 Jahre hält, wenn er bei 100mal so hellem Licht ein Jahr hält. Wenn jetzt aber der Zerfallsprozess z.B. durch eine Umweltchemikalie (z.B. aus Autoabgasen) stark beschleunigt wird und man beim Schnellalterungstest nicht auch diese Chemikalie in entsprechender Menge vorgesehen hat, ist der Test so gut wie wertlos. Ebenfalls unberücksichtigt würde in unserem einfachen Test ein Zerfall des Papiers selbst durch Feuchte oder andere Faktoren bleiben.
Aber ob Beständigkeit überhaupt ein Kriterium für ein Kunstwerk ist, mag spätestens seit der Fettecke von Beuys dahingestellt sein. Ich persönlich würde sie bei einem Foto, dessen Wert zum Teil dokumentarischer Natur ist, auf jeden Fall fordern.
Die fotografische Qualität der PE-Papiere ist ebenfalls inzwischen mindestens so gut wie die von Barytpapier. Spätestens aber dann, wenn das Bild unter Glas steckt, kann Ihnen kein Experte mit mehr als 50%iger Wahrscheinlichkeit sagen, ob es auf PE- oder Barytmaterial vergrößert ist. (50% ist die Trefferwahrscheinlichkeit, die Sie haben, wenn Sie zwischen zwei Möglichkeiten blind wählen.)
Zu (2): Nachdem die ersten Computerausdrucke nicht nur qualitativ minderwertig waren (Schließlich waren Farbdrucker zunächst nur für farbige Charts, Folien und ähnlich kurzlebiges Bürozeugs gedacht.), sondern auch nur kurze Zeit ansehnlich blieben, hat sich viel getan. Ausdrucke können inzwischen nicht nur Dichtewerte erreichen, die mit denen von Fotopapier vergleichbar sind, die Tonwertwiedergabe genügt heute auch hohen bis höchsten Ansprüchen, und Digitalausdrucke können – entsprechende Paarung von Papier und Tinte angenommen – auch von gleicher oder sogar besserer Langlebigkeit sein als nasschemisch erzeugte. Auf jeden Fall kann hier der Fotograf kaum etwas falsch machen, das die Langlebigkeit seines Prints in Gefahr bringen könnte. (Ausnahmen sind höchstens Fixativsprays, die vor UV-Licht schützen sollen. Manche dieser Sprays schützen zwar vor UV-Licht, reagieren aber selber mit den Farbstoffen der Tinten und versauen so das Bild.)
Zu (3): Je nach Bildinhalt (z.B. Reportage mit Live-Charakter) kann Fehlbelichtung oder auch mangelnde Schärfe oder auch fast jeder andere technische Fehler zu einer Steigerung der Bildaussage führen, so dass man sie nur eingeschränkt als Kriterium verwenden kann.
Zu (4): De gustibus non est disputandum – über Geschmack lässt sich nicht streiten. Vieles, was schlauere Leute als ich als meisterhaftes Foto ansehen, ist aus meiner – zugegeben intoleranten und stückweise zynischen – Sicht nicht das Papier wert, auf dem es vergrößert wurde. Manches möchte ich nicht sehen, aber ich kann mich ihm nicht entziehen. Hier öffnet sich daher ein weites (Minen-)Feld, das ich nicht betreten möchte.
Wodurch wird denn nun ein Foto zum „qualitativ hochwertig verarbeiteten“ Master Print? Natürlich kann jeder „Fehler“ auch ein Stilmittel sein, da Kunst gerade davon lebt, Regeln zu brechen. Diesen Vorbehalt mögen Sie im Kopf behalten. Aber aus meiner Sicht sollte ein Master Print eine hohe handwerkliche Qualität aufweisen. D.h. dass das Bild liebevoll verarbeitet sein sollte. Bildfehler wie Staub, Kratzer usw., schludrige Verarbeitung, die die Beständigkeit gefährdet, nicht anständig getrocknete, wellige Bilder usw., all dass sind Aspekte, die ich bei einem Master Print nicht dulden würde. Das stellt aber gerade mal einen Mindeststandard dar.
Muss die Herstellung eines Master Prints aufwendig sein und Dutzende von Nachbelichtungen und Retuschen involvieren? Muss sie nicht! Man kann durchaus auch Negative erzeugen, die schon als „straight prints“ nicht mehr verbesserungsfähig sind. Das kann nicht nur ein Meister unseres Fachs, sondern auch ein Amateur mit Glück. Was aber den Glückstreffer vom Meisterbild unterscheidet, ist der Aspekt der Konsistenz. Ein Meister erzeugt nicht ausschließlich, aber immer wieder Meisterbilder, während Glückstreffer meist Einzelereignisse sind und bleiben. Demnach wäre nach meiner Definition ein absolut tolles Glückstreffer-Bild, wie gut es auch aussehen mag, kein Master Print! Ich halte das aber nicht für einen Fehler der Definition, denn mit einem Glückstreffer wird man nicht zum Meister. Die Bezeichnung „Meister“ beinhaltet nach meinem Empfinden auch den Aspekt der Kontinuität in der Beherrschung der Elemente des Handwerks.
Eine schwierige Rolle bei der Frage, ob etwas ein Master Print ist oder nicht, spielt die Auflagenhöhe. Nach meinem Verständnis kann ein Massenprodukt kein Master Print sein. Das würde dafür sprechen, jegliches digitale Produkt, da es ja im Grundsatz in unbegrenzter Auflage reproduzierbar ist, gleich auszuschließen. Aber auch die digitale Erzeugung eines Bildes kann erheblichen Aufwand beinhalten und Zeugnis über Meisterhaftigkeit ablegen. An dieser Stelle scheint es mir unmöglich, eine scharfe Grenze zu ziehen. Ich denke, das wird der Markt selber regeln. Schließlich stand man z.B. bei Radierungen einmal vor demselben Problem. Ein Kunstwerk wird, ganz im Einklang mit dem Gesetz von Angebot und Nachfrage, um so teurer, je geringer seine Auflage, und so gab es durchaus Fälle, wo die Druckplatten nach Anfertigung einer limitierten Auflage eines Drucks zerstört wurden. Ein digitales Analogon bestünde darin, nach Ausdruck einer bestimmten Anzahl von (möglichst benummerten und signierten) Kopien die Datei nebst allen gesicherten Versionen zu löschen.
Nachdem wir nun, wenn auch noch mit gewissen Unsicherheiten geklärt haben, was ein Master Print ist, gleich die nächste Frage:
Was ist ein Vintage Print?
„Vintage“ kommt m.W. aus dem Weinbau und bedeutet „Jahrgang“. Die Definition des Vintage Prints liegt also nahe:
Ein Vintage Print ist ein Print, der in zeitlicher Nähe zur Aufnahme erzeugt wurde.
Was hat der Jahrgang mit einem Foto zu tun? Vintage Prints berühmter Fotografen werden wie Jahrgangssekte i.d.R. zu höheren Preisen gehandelt als spätere Abzüge. Das ist so, weil man in der Tatsache der zeitlichen Nähe ein Indiz dafür sieht, dass der Vintage Print eine größere Ursprünglichkeit aufweist als ein vom selben Negativ später erzeugter Print. Eine scharfe Grenze für die zeitliche Nähe gibt es m.W. nicht. Da es üblich ist, auf dem Bild aus Gründen des Urheberrechtsschutzes die Jahreszahl der Herstellung zu vermerken, kann man in erster Nähe davon ausgehen, dass ein Vintage Print im selben Jahr vergrößert wurde, in dem das Negativ aufgenommen wurde.
Vintage Prints sind nicht unbedingt die technisch besten Prints von einem gegebenen Negativ. Da sich innerhalb der letzten Jahrzehnte die Vergrößerungsoptiken und in noch viel höherem Maß die Papiere verbessert haben, könnte ein Fotograf wie Ansel Adams, wenn er bestimmte Negative heute noch einmal vergrößern würde, sicher technisch bessere Prints erzeugen, aber diese hätten ihre Ursprünglichkeit, den direkten Bezug zur Aufnahmesituation, zur Persönlichkeit, zum Können und zum Stil des Fotografen zur Zeit der Aufnahme, verloren.
Es bleibt aber dabei, dass bei Foto-Auktionen Vintage Prints in aller Regel teurer sind als spätere Abzüge oder gar undatierte. Wenn Sie gedenken, einmal berühmt zu werden, denken Sie (auch im Sinne Ihrer Erben) also jetzt schon daran, in dokumentenechter Tinte Daten auf Ihren Prints zu vermerken und diese zu signieren.
Wie hoch sind denn nun die Preise für Fotos?
Eine Orientierung liefern Auktionskataloge wie der von Dietrich Schneider-Henn in München. Der, den ich vor kurzem in den Fingern hatte, lieferte einen breiten Querschnitt von anonymen Fotos von Anno Dazumal bis hin zu eigenhändigen Prints bekannter Größen wie Araki, Feininger, Steinert, Vogel, um nur ein paar zu nennen (in alphabetischer Reihenfolge, keine Wertung beabsichtigt). Während die anonymen Prints mit Startpreisen ab 100 bis 200 Euro gelistet waren (teils einfach deswegen, weil sie alt sind und damit „Geschichte“ darstellen), waren die Preise für die Prints der „Großen“ durchweg vierstellig. Die Spitze hielt ein Steinert-Print mit einem Startpreis von EUR 9.000.
Davon können die meisten von uns beim Verkauf eines Bildes nur träumen. Gängigere Preise für hochwertige Vergrößerungen liegen wahrscheinlich im Bereich von EUR 20 bis 40 für eine 18 x 24-Vergrößerung PE-Papier bis hin zu EUR 200 bis 400 für eine solche im Format 40 x 50 cm auf Baryt, um einmal die Enden der Skala zu beleuchten.
Was sagen die Kunden dazu?
Das hängt von den Kunden ab. Otto Normalverbraucher besitzt selber eine Knipskamera (analog oder digital – egal) und kennt die Plakate vom Drogeriemarkt an der Ecke, auf denen „brillante Abzüge“ für 1 Cent angeboten werden. Für das „schöne Foto“ von seiner Enkelin im Kindergarten, für das Sie Stunden in unbequemer Haltung zwischen lärmenden Kindern im Sandkasten verbracht haben und nach dem Sie hinterher ihre Kamera wegen der Knirschgeräusche zur Reparatur bringen mussten, für dessen Vergrößerung Sie schließlich einige Zeit in der Duka und hinterher am Retuschepult verbracht haben (All das weiß er nicht!), wird er Ihnen sicher ein paar Euro „Gewinn“ gönnen. Er wird also nicht meckern, wenn der 18 x 24-Abzug (Oh, so groß!) 5 Euro oder 10 Euro kostet, aber 20 bis 30? Er wird auch in den allermeisten Fällen nicht so sehr auf die technische Ausarbeitung des Prints gucken, da er vom Inhaltlichen mehr angetan ist. Das macht Sie als künstlerisch ambitionierten Fotografen nicht glücklich, aber Sie sollten es berücksichtigen. Insbesondere dann, wenn Sie Bilder ohne formelle Fotografiererlaubnis aufnehmen, kann es wichtig werden. Streng genommen dürfen Sie nämlich Bilder von Menschen nicht ohne deren Zustimmung (oder die Zustimmung der Erziehungsberechtigten im Falle von Kindern) veröffentlichen. Und eine „Veröffentlichung“ ist es im strengen juristischen Sinne auch, wenn Sie im Kindergarten eine Mappe herumgehen lassen, nach der die Kinder oder Eltern die Fotos bestellen können. Wenn sich jetzt jemand, der das Stichwort vom „Recht am eigenen Bild“ nur einmal am Rande gehört hat, ärgert, weil scheinbar jemand an einem Bild von seinem Kind richtig viel Geld verdient...
Wenn Sie also hinsichtlich der Preise in dieser Liga spielen wollen, tun Sie gut daran, sich vorher der Zustimmung der Beteiligten zu versichern und diese nötigenfalls auch durch die (dann aber auch einzulösende) Zusage zu erkaufen, ihnen hinterher ein Bild zu schenken. (Es muss ja kein 50 x 60-Barytprint sein.) Muss ich noch extra erwähnen, dass Sie auch tunlichst Sorge tragen sollten, dass die Bilder nicht zu schnell irgendwelchen Umwelteinflüssen zum Opfer fallen? (Ich erlaube mir an dieser Stelle einen Verweis auf meinen Artikel zur archivfesten Behandlung von Prints, siehe Archivfeste Tonungen). Unzufriedene Kunden sind schließlich auf die eine oder andere Weise des Freischaffenden Tod.
Tod – dieser etwas zynische Einschub sei gestattet – ist übrigens auch ein Weg, seine Fotos teurer zu machen. Die meisten Kunstwerke werden erst nach dem Ableben des Künstlers so richtig teuer. Pech, dass Sie dann nichts mehr davon haben!
Sehen Sie auch davon ab, 2.-Wahl-Fotos zu verschenken oder zu reduzierten Preisen zu verscherbeln. Wenn Sie den Sprung wagen, Ihre Fotos zu verkaufen, um Geld zu verdienen, verkaufen Sie nur 1a-Qualität mit Brief und Siegel. Irgendwer sieht sonst den verschenkten Ausschuss irgendwo an der Wand hängen und findet womöglich auch noch heraus, dass das Bild von Ihnen ist. Was das für Ihr Image bedeutet, sollte klar sein.
Wer auf der anderen Seite ein Bild als Kunstwerk ersteht und sich daher des ideellen Wertes bewusst ist, wird höhere Preise eher schlucken, sich möglicherweise sogar als Mäzen fühlen. Denn schließlich gehen die meisten Leute doch unbewusst von dem alten Sprichwort aus „Wat nix kost’, is auch nix!“
Schlusssatz
In Anspielung auf eine mir langsam, aber sicher, auch nicht immer, aber immer öfter auf den Wecker fallende Serie einer Radiostation schließe ich meine Überlegungen mit den Worten: „Und nun kennen Sie diewahre Geschichte.“ Ich hoffe dabei, dass es Ihnen mit meinen Artikeln auf die Dauer nicht ebenso geht wie mir mit besagter Serie: Vor vielen Jahren, als die Geschichten noch nicht so oft gesendet wurden, waren sie oft witzig und interessant. Heute, da offenbar jeden Tag ein paar davon ausgestrahlt werden, wirkt das Ganze etwas gezwungen. Sollte sich Ihnen bei der Lektüre meiner Kolumne derselbe Eindruck aufdrängen, so lassen Sie’s mich wissen, am besten gleich mit Nennung eines absolut prickelnden Themas für eine noch zu schreibende Kolumne, die Sie interessieren würde. Bedenken Sie dabei aber bitte, dass auch ich Amateur bin und diese Kolumne unbezahlt schreibe. Mein Forschungsetat ist also begrenzt.
Kleine Tipps, die das (fotografische) Leben erleichtern
Teil 3: Beim Vergrößern
Thomas Wollstein
Januar 2004
Zunächst ein Nachtrag
Ich hatte Sie, liebe Leserinnen und Leser, aufgefordert, mir auch Ihre Tipps und Tricks zurückzumelden, um sie anderen Lesern zugänglich zu machen. Ganz besonders der Tipp von Herrn Rolf Rettenberger verdient Erwähnung. Er bezieht sich auf die störrischen Polyester-Filme:
Wie schon einige von uns hat sicher auch Herr Rettenberger geflucht, als er versuchte, sich windende Negativstreifen in Ablageblätter zu fummeln. Seine Idee zur Lösung des Problems ist so nahe liegend wie wirksam: Nach dem Trocknen rollt er den Film „gegen den Strich“, d.h. mit der Emulsionsseite nach außen, wieder auf und lässt ihn so einen weiteren Tag liegen. Danach ist der Film brav und bleibt einigermaßen glatt liegen. Eigentlich logisch, nicht wahr?
Fast erübrigt es sich, darauf hinzuweisen, dass hier große Vorsicht am Platze ist, um die Negative nicht zu verkratzen. Vergleichsweise einfach haben es Rollfilm-Benutzer: Sie kleben den trockenen Film wieder auf das Schutzpapier (das sie hoffentlich nicht gleich weggeworfen haben). Damit ist ein ziemlich guter Schutz gegeben. Bei KB-Filmen kann man sicher auch eine Papierschicht mit einrollen, aber aufgrund der geringen Rollenbreite des Films und der leichten Krümmung der Negative quer zur Längsachse des Films kann man KB-Filme auch ohne besondere Schutzmaßnahmen in dieser Weise „vergewaltigen“. Nur vorsichtig muss man halt sein. Man braucht den Film ja auch nicht sehr eng aufzuwickeln. Eine Variante besteht darin, den Film mit der Emulsionsseite nach außen spiralförmig auf eine Rolle (Ein großer – sauberer – Jobo-Tank eignet sich hervorragend.) wickeln. Dabei liegt dann nichts auf der Schicht.
An dieser Stelle Dank an Herrn Rettenberger. Doch nun zum Thema.
Dann noch eine Richtigstellung: Schon in einem früheren Artikel hatte ich einmal über Polyester-Filme geschrieben und dabei – wie zunächst auch im letzten Artikel – diese als PE-basierte Filme bezeichnet. Das ist nicht richtig. PE ist Polyethylen, wie Sie es von PE-Papieren, aber auch von Plastiktüten und Joghurtbechern her kennen. Es eignet sich m.W. nicht für Filmträger. Filmträger sind aus Polyethylenterephtalat, kurz PET (wie die „unkaputtbaren“ Getränkeflaschen). PET ist ein Mitglied der großen Familie der Polyester. Dank an Herrn Heymann, der mich auf diesen Lapsus aufmerksam machte und Dank an Herrn Löffler für die Korrektur im Dezember-Artikel.
Staub!
Eine ganze Kolumne habe ich bereits der Vermeidung von Staubflecken gewidmet (Trocknen). Zu Recht, meine ich, denn man kann eine Menge Zeit damit verbringen, Staubfitzelchen zu retuschieren. Ich habe Ihnen in besagter Kolumne mein System dargestellt, mit dem ich (fast) immer zu fleckenfreien Prints komme. Die Krux lag schon immer in dem „fast“. Inzwischen habe ich wieder etwas dazugelernt, was mir weitere Stunden in unergonomischer Haltung, mit Pinsel in der Hand und Kopflupe auf dem Kopf erspart.
Hintergrund war folgender: Während meine Methode, die Negative einfach mit einem dicken Pusteball, der einen wahrhaft brutalen Luftstrahl erzeugen kann, abzupusten in aller Regel hervorragend funktioniert und auch überhaupt keine Gefahr des Verkratzens der Negative birgt, gab es doch einzelne Tage, an denen ich aus dem Pusten gar nicht mehr herauskam. Pusten, Negativ in den Vergrößerer einlegen, projizieren, Projektion auf Staubflecken prüfen, zurück auf Los. So konnte das an manchen Tagen lange lange gehen. Immer war wieder eine neue Staubfaser auf dem Film. Wie Sie meinen Kolumnen entnommen haben werden, versuche ich, möglichst reproduzierbar zu arbeiten. So konnte ich relativ schnell viele mögliche Ursachen für die fatale Affinität des Staubs zu meinen Negativen ausschließen. Die Tatsache, dass sich dasselbe Negativ an einem Tag gut benahm und an einem anderen schlecht, ließ dann nur den Schluss zu, dass es am Wetter oder etwas Ähnlichem lag.
Unlängst hatte ich nun das Vergnügen, Walter Vogel, Autor vieler Bücher [1] und Kalender mit hervorragenden SW-Fotos und Masterprinter der alten Schule, in seiner Dunkelkammer über die Schulter schauen zu dürfen. Dabei fiel mir auf, dass er seine Negative vor dem Einlegen in den Vergrößerer grundsätzlich anhauchte und dann mit einem Läppchen abwischte. Ich hatte mechanische Reinigung bisher wegen des Kratzerrisikos grundsätzlich abgelehnt, musste aber zugeben, dass keines seiner Fotos Anzeichen von verkratzten Negativen zeigte. (Außerdem diskutiert sich’s schlecht einem sich über 50 Jahre Berufspraxis erstreckenden Erfolg.) Grund genug also, es zu probieren. Der Erfolg spricht für sich. Seit dem Tag, da ich meine Negativstreifen – nur die glänzende Rückseite, nicht die Emulsionsseite – anhauche und dann – auch nur die Rückseite – mit dem bereits im oben zitierten Artikel empfohlenen Taschentuch abwische und dann abpuste, gab es keine hartnäckigen Probleme mehr.
Warum? Ich vermute, dass das hartnäckige Haften der Staubteilchen an manchen Tagen auf elektrostatische Aufladung zurückgeht. Ladungen bauen sich durch Reibung verschiedener Materialien an einander auf. Das können z.B. ungeeignete Negativ-Ablageblätter sein, die sich ja nun zwangsweise an den Filmstreifen reiben, es können aber auch Materialpaarungen in Ihrer Kleidung sein. An Tagen, an denen die Luft besonders trocken ist, bauen sich solche Ladungen nur langsam ab. Wenn man nun weiß, dass die elektrostatische Anziehungskraft besonders auf geringe Distanz sehr stark ist, fällt es leicht zu glauben, dass sie die Ursache des Problems ist. Das Anhauchen des Films umgibt ihn mit feuchter Luft, und die könnte dazu führen, dass die vorhandenen Ladungen abgebaut werden. Damit ist die starke Anziehungskraft neutralisiert, und der Pusteball hat leichtes Spiel. Das Wischen allein kann nicht der Grund sein, zumal es nur auf der Filmrückseite erfolgt.
Korn!
Auch mit der Einführung der modernen Kristallstrukturen vor rund 25 Jahren ist das Thema Korn nicht gelöst. Dabei ist das Verhältnis zum Korn ein gespaltenes: Eine Fläche einheitlichen Graus, z.B. der zarte Teint eines hübschen Modells, durch Korn zerrissen, kann ein ganzes Bild versauen. Andererseits kann Korn den Schärfeeindruck deutlich verstärken.
|
Zwischenruf: Wie kann Korn den Schärfeeindruck verstärken? Der Schärfeeindruck entsteht im Gehirn, und das Gehirn lässt sich – das zeigen viele optische Täuschungen – auch austricksen. Auch ein Print von einem nicht wirklich scharfen Negativ kann scharf erscheinen, wenn er viele feine, scharf wiedergegebene Details enthält. Dass die Details, wenn es sich um Korn handelt, keine eigentliche Bildinformation transportieren, sondern eher optisches Rauschen sind, macht nichts. Voraussetzung ist in solchen Fällen nur, dass das Auge die scharfen Details auflösen kann. |
Gehen wir aber einmal davon aus, wir wollen Korn vermeiden. Vor 25 Jahren, noch vor der Zeit der T-, Flach- und Super-Fine-Sigma-Kristalle habe ich folgenden Tipp gelernt, den ich mit Erfolg auch heute noch in manchen Fällen einsetze: Für rund 1/4 bis 1/3 der Belichtungszeit halte ich einen leichten Weichzeichner unter das Vergrößererobjektiv. Das tut der Schärfe etwas Abbruch und mindert die Aufdringlichkeit des Korns ganz erheblich. Man muss von Fall zu Fall entscheiden, was einem wichtiger ist.
Ein ganz ordentlicher Weichzeichner für diesen Zweck lässt sich aus einem Stück Nylon-Strumpf herstellen, den Sie über eine Papprolle spannen.
Nicht weich genug?
Nach der Lektüre vieler einschlägiger Bücher hatte ich früher den Eindruck, Papier wäre grundsätzlich zu hart, und der Segen könne nur in weichem Papier liegen. Es scheint zunächst auch logisch: Der Dichteumfang des Negativs ist oft so groß, dass kein Papier ihn wiedergeben kann. Weiches Papier hat den größtmöglichen Dichteumfang, also muss man weiches Papier verwenden. Richtig? Falsch!
Weiches Papier komprimiert die gesamte Tonwertskala, d.h. die Extremwerte, Lichter und Schatten, werden zwar in den abbildbaren Bereich geholt, aber sie und alles, was zwischen ihnen liegt, werden nur wenig differenziert. Heraus kommt ein Print mit schlapper Tonwertwiedergabe.
Wo liegt der Hase im Pfeffer? Für ein gutes Bild ist nach meinem Dafürhalten der Lokalkontrast viel entscheidender als der Globalkontrast. Innerhalb einzelner Tonwertbereiche und einzelner lokaler Bereiche, also innerhalb der Schatten, der Mitteltöne oder der Lichter, brauchen Sie gute Differenzierung, d.h. hohen Kontrast. Sie werden in den allermeisten Fällen ein viel befriedigenderes, brillanteres Bild bekommen, wenn Sie auf härteres Papier vergrößern und den Kontrast dadurch kontrollieren, dass Sie einzelne Bereiche abhalten oder nachbelichten. So können Sie nämlich lokal, innerhalb der Tonwertbereiche, die bessere Differenzierung der härteren Gradation nutzen, aber global trotzdem den Kontrast ans Papier anpassen.
Das Verfahren beruht z.T. darauf, dass das Auge ganz kläglich versagt, wenn es Ähnlichkeiten oder Unähnlichkeiten räumlich getrennter Tonwerte beurteilen soll. Das will sagen, dass Sie ungestraft damit davonkommen, wenn Sie zwei im Motiv (und auch noch im Negativ) sehr ähnliche, aber räumlich gut von einander getrennte Tonwerte (z.B. den Hautton eines Menschen in der Bildmitte und den eines Menschen am Bildrand) im Positiv verschieden wiedergeben (z.B. durch Abdunkeln des Bildrandes). Wenn der Unterschied nicht gar so groß wird, werden dem Auge (eigentlich dem Gehirn) die beiden Hauttöne immer noch ähnlich oder sogar identisch erscheinen.
(Streng genommen ist das natürlich kein Tipp oder Trick, sondern eine Anregung an Sie zum Experimentieren, aber es passte als Überleitung zum folgenden Punkt gut hierhin.)
Nicht hart genug – eine relativ einfache Rettungstechnik für unterbelichtete oder unterentwickelte Negative
So pedantisch wie ich normalerweise arbeite, passierte es mir neulich doch: Ich hatte einen Film, der ziemlich katastrophal unterentwickelt war. Selbst auf Gradation 5 ließen sich keine vernünftigen Prints erzeugen.
Was tun? Ein unterentwickeltes Negativ hat viel zu wenig Kontrast. Sie brauchen also zum Vergrößern ein Papier mit extremem Kontrast. Bei Papier mit geringfügig zu geringem Kontrast lässt sich durch Verwendung eines härteren konventionellen Entwicklers, z.B. AMALOCO AM 30G, Tetenal Dokumol oder LP-DOCUFINE HC, Abhilfe schaffen. Das kann Ihnen bis zu einer halben bis ganzen Gradationsstufe bringen. Wie viel genau, hängt vom Papier ab.
Aber wirklich „hammerharte“ Bilder können Sie mit Lith-Entwickler erzeugen. Tim Rudman behauptet im Master Photographer’s Lith Printing Course [2], man könne mittels Lith-Entwicklung Gradation von 7 und höher (auf der nach oben offenen Richter-Skala) erzeugen. Bei meinem Sorgenkind klappte das ganz hervorragend: Das „echte“ Lith-Verfahren beruht darauf, das Bild erheblich (um zwei bis drei Blenden und teilweise noch mehr) überzubelichten und die Entwicklung am richtigen Punkt abzubrechen, wenn die Schatten hart ausdifferenziert und die Lichter weich abgestuft sind. Wie bei Film erhält man durch langes Belichten und kurzes Entwickeln weiche „Gradationen“, durch kurzes Belichten und langes Entwickeln harte. In meinem Fall habe ich mit „normalen“ Zeiten belichtet und lange ausentwickelt. Das Ergebnis waren hart wirkende Prints von extrem weichen Negativen.
Wo der braune Ton eines Lith-Prints nicht zur Bildaussage passt, können Sie ihn nachträglich entfernen: Tauchen Sie das Bild für eine Weile in Tetenal Goldtoner. Der Farbton verschiebt sich mit längerer Einwirkzeit des Toners (und je nach Papier) über neutral bis hin zu einem kräftigen, extrem tiefen Blauschwarz.
Das Verfahren hat natürlich Nebenwirkungen: Aufgrund des hohen Kontrastes kommt es zu einer deutlichen Betonung des Korns, und die Bilder erhalten oft einen fast grafischen Stil. Dennoch sind die Ergebnisse (s. Beispiel) nach meinem Empfinden durchaus sehenswert. Ein Beispiel ist das hier gezeigte Bild aus einer Ballettstunde.

Es gibt natürlich noch andere Rettungstechniken, z.B. das Umkopieren auf Dokumentenfilm, Dunkelfeldreproduktion, aber die sind wesentlich aufwendiger als das zuvor beschriebene Verfahren.
Ein weiteres einfaches Verfahren zur Kontraststeigerung eines Negativs besteht darin, es mit Selentoner zu behandeln. Selentoner wirkt, besonders, wenn man nicht voll tont, in den dichten Partien eines Negativs stärker als in den dünnen. Daher führt er zur Anhebung des Gesamtkontrasts, die Schattendichte oder –zeichnung wird nicht verbessert. Dabei soll (Ausprobiert habe ich es noch nicht.) das Korn nicht beeinflusst werden. Die Angaben über den erzielten Gewinn schwanken zwischen 1/3 und 1 Blende. Nachteil dieses Verfahrens ist natürlich, dass es nur mit dem Originalnegativ geht und irreversibel ist. (Diese Technik verdient sicher zu gegebener Zeit einmal eine eigene Kolumne.)
Noch einmal: nicht weich genug?
Das geht natürlich auch anders herum: Auch zu den weichen „Gradationen“ hin ist das Lith-Verfahren fast unbegrenzt anpassbar. Belichten Sie lange und brechen Sie die Entwicklung ab, wenn die Schatten gut aussehen. Sind die Lichter dann noch undifferenziert, belichten Sie noch länger und entwickeln noch kürzer. Zusammen mit Abwedel- und Nachbelichtungstechniken lässt sich so ein Spektrum an Dichten ins Positiv retten, von dem Sie bei konventioneller Arbeitsweise kaum zu träumen wagen.
Eigenbau-Verdunkelung
Als ich mit zarten 15 Jahren daran ging, das heimische Bad zeitweise in eine Dunkelkammer umzubauen, musste ich erst einmal feststellen, wie schwierig es ist, einen Raum wirklich dunkel zu bekommen. Was gleich nach dem Eintritt dunkel aussieht, ist nach wenigen Minuten bestenfalls noch Halbdunkel, wenn die Augen dunkeladaptiert sind. Nun wollte ich damals aber aus Geldmangel unbedingt Film-Meterware verarbeiten und hatte natürlich auch kein Geld für ein Einspulgerät. Was also tun? Ganz einfach: Unsere Badewanne war genau so lang wie ein KB-Film mit 36 Bildern. Ich brauchte also nur das Ende der Rolle am Ende der Badewanne mit einem Stück Klebeband anzupappen, eine Badewannenlänge abzurollen, zu kappen und am anderen Ende anzukleben usw. Dazu musste es aber wirklich dunkel sein, denn selbst niedrigempfindlicher Film ist viel empfindlicher als hochempfindliches Papier. (ISO 25/15° für langsame Filme steht für schnelle Papiere ein Wert gegenüber, der ISO 3/6° entspricht, immerhin rund 3 Blenden Unterschied.)
Reich war ich nicht, so dass die professionellen Vorhänge, wie sie in Röntgenlabors und Profi-Dukas zum Einsatz kommen, keine Option waren. Aber erfindungsreich war ich. Ich habe so ziemlich jedes lichtdicht aussehende Material vors Fenster gehängt. Sie glauben gar nicht, wie viel Licht z.B. durch dicke Pappe, Teppich-Auslegeware (!), dicken schwarzen Stoff usw. dringt. Bei den plattenförmigen Materialien ist zudem das Problem, Ritzen zu vermeiden.
Ich will an dieser Stelle mal lieber nicht darüber sinnieren, wie viel Geld ich für nutzloses Material ausgegeben habe. Schließlich kann man ja nicht im Laden prüfen, ob der Stoff lichtdicht ist. Oder doch? Eines Tages ging ich mit meinem guten Bauer-Blitzgerät bewaffnet in den Stoffladen und ließ mir den billigsten schwarzen Stoff zeigen, den es gab. Ich legte nach und nach so viele Lagen Stoff über den Blitz, bis bei höchster Leistungseinstellung nichts mehr durchkam. Dann noch eine Lage drauf, nur so zur Sicherheit. Ich kaufte für wenig Geld die entsprechende Menge Stoff, um mein Fenster verhängen zu können, nähte die Lagen mit Omas Nähmaschine auf einander, und bis heute habe ich eine absolut dichte Verdunkelung zu konkurrenzlos niedrigem Preis. Die Stoffbahn wird zwischen Fenster und Rahmen eingeklemmt. An den Seiten ist genug Überstand vorhanden, um den Stoff so zu hängen, dass keine Lücken entstehen.
Duka-Taschenlampe
Spezielle Duka-Taschenlampen sind unbezahlbar. Das gilt mehr für den Nutzen, den sie bringen, als für den tatsächlichen Preis. Sie können sich jedoch ganz einfach eine solche Lampe selber basteln: Ich habe mir aus einem Rest eines Kodak Wratten Gelatinefilters Nr. 29 (tiefrot) und einer kleinen Taschenlampe eine Duka-Taschenlampe gebastelt. Funktioniert prima und kostete nicht halb soviel wie eine käufliche Duka-Minileuchte. (Dieser Tipp ist nicht neu. Ich habe ihn aus der Kolumne über Licht in der Duka, Grauschleier, kopiert.)
Riesenbilder auf engem Raum verarbeiten
Schalen mit Seitenlängen ab 50 cm sind nicht nur teuer, sie brauchen auch extrem viel Platz und Unmengen an Chemie. In meine Badezimmer-Duka passen schlicht keine vier (Zweibad-Fixage!) so großen Schalen. Trotzdem hängen in meiner Wohnung Bilder aus meiner Panoramakamera, die ich auf ungefähr 40 ´ 100 cm vergrößert habe.
Den Trick, solche Bilder mit wenig Entwickler in der Badewanne mittels eines Schwamms zu entwickeln, hat inzwischen bestimmt jeder schon einmal gehört. Ich habe ihn genau ein Mal ausprobiert. So eine Sauerei! Der Lohn für längeres anstrengendes Hängen über der Badewanne war ein trotz des verdünnten Entwicklers ungleichmäßig entwickeltes, wegen des verdünnten Entwicklers kraftloses Bild mit Knicken und Oberflächenschäden. Dass der Entwickler dann auch noch durch den Gulli ging, war ein weiteres Problem.
Auch die Variante, solche Bilder in einem Blumenkasten zu entwickeln, indem man sie durch den Entwickler hin- und herzieht, ist meines Erachtens unpraktikabel. Schon ohne die in den meisten Blumenkästen vorhandenen Grate und Verstärkungen ist es fast unmöglich, bei diesem Verfahren Knicke und Kratzer zu vermeiden.
Zwei Varianten habe ich ausprobiert, die ich dagegen empfehlen kann:
Variante 1: Arbeit in einer großen Schale
Bei Bildern mit noch halbwegs normalen Maßen kommen Sie mit einer großen Schale aus. Filme entwickeln Sie auch in einem Tank, in den Sie die Chemikalien nacheinander einfüllen. Machen Sie’s hier ebenso. In einer Schale des Formats 40 x 50 cm kann man mit sage und schreibe nur einem Liter Entwickler entwickeln, wenn man die ganze Zeit dafür sorgt, dass der Entwickler über das Bild hin- und herschwappt. Entwickeln Sie das Bild aus, dann können Sie nach der Entwicklung die ganze Schale mit dem Bild drin anheben und den Entwickler durch einen großen Trichter zurück in seine Flasche kippen. Ungleichmäßigkeiten treten so nicht auf. Führen Sie dann zwei bis drei Wässerungsschritte von je 1 min mit je 1 l Wasser durch, bevor Sie in derselben Schale fixieren. Sie können sogar in ebendieser Schale die Schlusswässerung durchführen. Bei PE-Papier sollten 5 Wasserwechsel mit je 1 min Einwirkzeit reichen. Bei Barytpapier sind 10 Wasserwechsel mit je 5-minütiger Einwirkzeit bei intermittierender Bewegung (ab und zu umrühren oder eine billige Tauchpumpe aus dem Bastelladen in die Schale stellen) ausreichend. Da würde ich dann allerdings ein Zwischenbad in einem Auswässerungsbeschleuniger (z.B. AMALOCO H 8, Kodak Hypo Clearing Agent, Soda- oder Sulfitlösung) vorschalten, eine etwas großzügigere Wassermenge ansetzen und darauf achten, dass das Wasser eine Temperatur von ungefähr 20 °C hat.
Wie gesagt: Beim Film findet es auch niemand komisch, alle Chemikalien in einem Gefäß zur Anwendung zu bringen. Und es geht natürlich in der ganz engen Mini-Duka auch in einer kleinen Schale.
Variante 2: Das Wollsteinsche Abflussrohr
Für diese Variante müssen Sie schon körperlich gut in Form und ein Extremist ein, der für seine Bilder ziemlich weit geht.
Aus einem Abflussrohr von 1 m Länge und mit einem Nenn-Innendurchmesser von 20 cm (Pardon, im Bauwesen redet man immer von Millimetern, also ist es ein Rohr DN 200.) lässt sich mit wenig bastlerischem Geschick ein Tank bauen, in dem Sie Bilder bis zu gut 60 x 100 cm verarbeiten können. (Umfang ist pi [Kreiszahl pi = 3,14...] mal Durchmesser, also gut 60 cm, Länge eben 1 m). Den Details einer solchen Bastelaktion könnte man fast eine ganze Kolumne widmen. Wer Interesse hat, spreche mich einfach an.
Chemie brauchen Sie hierbei auch nicht viel. 1 l ist ausreichend. Ich würde hierbei nur empfehlen, die Schlusswässerung nicht im Tank vorzunehmen, sondern in der Badewanne. Das Papier liegt an der Innenwand des Tanks an. Bei PE-Papier findet keine Diffusion durch den Träger hindurch statt, so dass kaum zu gewährleisten sein dürfte, dass nach der Wässerung hinter dem Papier keine Chemie mehr „gefangen“ ist.
Was Sie brauchen – diese Warnung muss sein – ist etwas Kraft und Ausdauer. Das Abflussrohr ist nicht – wie z.B. eine JOBO-Trommel – aus dünnwandigem und daher leichtgewichtigem Makrolon gefertigt, sondern aus dickem PVC. (Schließlich muss so ein Ding normalerweise über Jahre und Jahrzehnte in der Erde verbuddelt überdauern.) Ein solcher Tank ist also mit seiner Länge von gut 1 m und seinem Durchmesser von gut 20 cm genau so unhandlich wie schwer! Meiner wiegt 5,5 kg. Das klingt vielleicht nicht nach viel, aber hantieren Sie mal 5 bis 10 min mit 5,5 kg!
Die Größenverhältnisse zeigt das Bild, das mich (Ja, auch ich leide daran, oft äußerst dumm zu grinsen, wenn jemand eine Kamera auf mich richtet!) mit meinem Abflussrohr zeigt.
 |
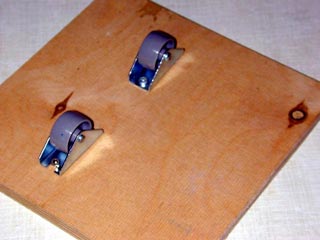 |
Mit ein paar Möbelrollen können Sie sich eine einfache Rollhilfe bauen (siehe Bild), auf die Sie den Tank zum Rotieren legen. Heben Sie bei der Rotation das eine Ende immer mal wieder an, um dafür zu sorgen, dass der Entwickler als Welle über das ganze Bild schwappt. Dann brauchen Sie auch dann keine Sorge zu haben, dass Bildteile trockenfallen, wenn der Tank nicht ganz in der Waage liegt.
Zum Auskippen müssen Sie dieses Trum dann doch anheben und kippen. Versichern Sie sich also im Zweifelsfall der Hilfe eines starken Kompagnons. Und passen Sie auf: Chemie, die, auch mit wenig Gefälle, ein 1 m langes Rohr entlangrauscht, kommt mit Schwung heraus. Beim JOBO-Tank bremst die Lichtschleuse die Suppe ab, bei der Selbstbaulösung nicht.
Gutes Stichwort: Lichtschleuse. Die hat eine einfache Selbstbaulösung natürlich nicht, so dass Sie beim Einfüllen und Ausgießen der Chemie doch im Dunkeln arbeiten müssen.
Nochmal Selbstbau: „Vergrößerungsrahmen“
Angesichts der Preise eines Vergrößerungsrahmens können einem schon die Tränen in die Augen steigen. Zwar ist so ein Zubehör i.d.R. eine Daueranschaffung, aber das Ding will dann auch gelagert sein, wenn man es nicht gebraucht. Und wie oft gebrauchen Sie einen Vergrößerungsrahmen für 40x50 cm oder gar größer? Trotzdem möchten Sie vielleicht auch einmal ein so großes Bild mit einem sauberen weißen Rand versehen, z.B. um Platz für Ihre Signatur zu haben.
Wenn Sie sich nach meinem Artikel über die Eigenanfertigung von Passepartouts einen Passpartoutschneider gekauft haben, haben Sie jetzt einen neuen Nutzen dafür gefunden: Schneiden Sie sich ein Passepartout mit dem gewünschten Ausschnitt aus billiger Pappe. (Nur lichtdicht genug muss sie sein.) Das legen Sie auf das zu belichtende Blatt Fotopapier, und schon haben Sie einen sauberen weißen Rand. Achten Sie besonders bei großen Formaten darauf, dass das Fotopaper plan liegt und der „Maskenrahmen“ gut aufliegt, sonst ist insbesondere an dunklen Bildstellen am Rand damit zu rechnen, dass diese in den weißen Rand hinein „ausbluten“. Sie vermeiden das, indem Sie die Pappe etwas beschweren, vorzugsweise aber mit flachen Gegenständen und nicht zu nahe am Rand, damit die senkrechten Flächen der Beschwerung nicht Licht auf das Bild reflektieren.
Zu guter Letzt: Laborkleidung
Es ist keine gute Idee, im feinen Zwirn in der Duka zu arbeiten. Manche unserer Chemikalien rufen schwer zu entfernende Flecken hervor. Entwickler ist mit am unangenehmsten. Mit viel Glück können Sie die braunen Entwicklerflecken, die durch Oxidation eines Entwickleragens entstehen, mit reduktiver Bleiche aus dem Drogeriemarkt abschwächen oder manchmal auch entfernen. Aber verlassen sollten Sie sich nicht darauf. Fixierbadflecken sind da schon weniger schwierig, denn es handelt sich um Silberflecken: Früher bot Tetenal eine Chemikalie namens Exargent an, die das Silber oxidierte und löste. Dann konnte man den Fleck auswaschen. Exargent gibt es leider nicht mehr. Zur Not tut’s aber auch Farmerscher Abschwächer (der allerdings leider selber sehr stark gefärbt ist, was neue Probleme geben kann) oder irgendeine andere, möglichst farblose (hier: oxidative) Bleiche, z.B. die Bleichlösung eines Toners. Danach tupfen Sie frisches Fixierbad auf die Stelle, wässern, und der Fleck ist weg.
Beachten Sie nur folgendes: Die meisten Farbstoffe in Kleidungsstücken lassen sich durch Bleichen, gleich ob oxidativ oder reduktiv ebenfalls sehr stark beeindrucken. Ich wollte einmal mit reduktiver Bleiche Flecken (keine Fotochemie!) aus einem roten Sweatshirt meiner Tochter entfernen. Die Flecken sind raus, und nachdem ich inzwischen das ganze Sweatshirt behandelt habe, hat meine Tochter ein fleckenloses – ockergelbes – Sweatshirt. Probieren Sie also an einer nicht zu auffälligen Stelle Ihres Textils aus (im Saum o.ä.), ob Material und Farbstoff sich mit der Bleiche vertragen. Sonst haben Sie nachher die Flecken raus, aber leider auch die Farbe. Klappt’s nicht, verwenden Sie das versaute Textil demnächst als Duka-Kleidung.
Sie vermeiden solche Probleme, wenn Sie nur in alten Klamotten in die Duka gehen. Die alte Jeans mit den Löchern und das verschossene T-Shirt sind gerade gut genug. Im Dunkeln sieht’s eh keiner. (Ach, die Jeans mit den Löchern war ein sauteures Ding, und die Löcher hat der Designer mühsam gestylt? Sorry, das konnte ich mit meinem begrenzten Sinn für Mode nicht wissen.)
Wirklich das Letzte...
... in 2003. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen.
[1] u.a. von Walter Vogel: Deutschland, Die frühen Jahre, Brandstätter (September 2002), Bon appetit, Brandstätter Vlg., Wien (Mai 1997), Espresso, Brandstätter (2001), Das Cafe, Brandstätter (April 2000), Das Cafe. Vom Reichtum europäischer Kaffeehauskultur, Brandstätter Vlg., Wien (Dezember 1996), Pina, Quadriga (September 2001). Dazu viele Kalender, Adressbücher usw. Das schöne Buch Italien. Reisen in ein Bilderland ist leider eingestellt.
[2] Rudman, Tim, The Master Photographer's Lith Printing Course, Amphoto Books, New York 1999, ISBN 0-8174-4539-0
Einen Nachtrag zu diesem Artikel finden Sie im nächsten Kolumnenbeitrag.
Kleine Tipps, die das (fotografische) Leben erleichtern
Teil 2: Bei der Verarbeitung und Entwicklung
Thomas Wollstein
Dezember 2003
Polyesterfilme reißen nicht!
Als ich meinen ersten MACO CUBE 400c entwickelte, gab es beinahe eine Katastrophe: Wie üblich hatte ich die Filmzunge im Hellen abgeschnitten und den Filmanfang von Ecken befreit (siehe Grauschleier). In den Wechselsack kamen dann ein Flaschenöffner zum Knacken der Patrone, der Tank und die Spirale. Das Einspulen verlief auch ganz ordentlich. (Da ist Polyester nach meinen Erfahrungen viel gutmütiger als Triazetat.) Dann vorsichtig fühlen, ob am Ende Klebeband sitzt oder der Film in den Spulenkern eingehängt ist. CUBE ist eingehängt. OK. Wie üblich wollte ich ihn vorsichtig abreißen. Da hatte ich mit Zitronen gehandelt! Der ließ sich einfach nicht abreißen. Und eine Schere in den Wechselsack holen war jetzt auch nicht mehr drin, da der Film schon aus der Patrone raus war. Da fiel mir dann auch wieder eine Geschichte aus der Praxis der Verkehrspolizei ein, die ein Bekannter mir erzählt hatte, und die ich unter dem Stichwort Fotografenlatein verbucht hatte. Er hatte behauptet, Kollegen hätten in Ermangelung eines Abschleppseils mithilfe eines Verkehrsüberwachungsfilms auf Polyesterträger ein Auto abgeschleppt. Ich hatte das damals als Blödsinn abgetan, aber es wurde plötzlich erheblich glaubhafter. Sei es nun wahr oder nicht: Ich habe den Film mit viel Mühe abdrehen können und hatte auch das Glück, dass das letzte belichtete Bild noch reichlich vor dem Filmende lag. So wurde es nicht durch meine Fingerabdrücke versaut.
Fazit 1: Bei Filmen mit PET-Träger sollten Sie eine Schere mit in den Wechselsack nehmen.
Fazit 2: Wenn Sie einen PET-Film in der Kamera haben, transportieren Sie NIE mit Gewalt. Der Film hält, die Kamera muss dann Ihre ganze Kraft ertragen, was nicht jede verträgt.
Der Widerspenstigen Zähmung: Planlage von Polyesterfilmen
Filme auf Polyesterbasis – das wurde an anderer Stelle schon erläutert – sind mechanisch wie chemisch haltbarer als solche auf Triazetatbasis. Die Kehrseite ist, dass solche Filme auch wirklich widerspenstig sein können. Wenn Polyester einmal eine Krümmung hat, neigt es dazu, diese zu behalten. Haben Sie also Ihren Kodak HIE, MACO CUBE 400c, Agfa Copex Rapid oder Kodak Imagespeed HQ ähnlich endlich entwickelt und ausgewässert und zum Trocknen über Nacht aufgehängt, finden Sie am nächsten Morgen in der Duschkabine etwas vor, das stark an einen Fliegenfänger erinnert: Der Film hängt da, zusammengezogen wie ein Korkenzieher. Wie schlimm es wird, hängt noch ein bisschen vom Film und den Trocknungsbedingungen (Temperatur, Restfeuchte) ab.
Bei polyesterbasierten Filmen ist es mehr als nur empfehlenswert, beim Trocknen das untere Ende des Films mit einem schweren Clip zu versehen. Dass der Film reißt, brauchen Sie eigentlich nicht zu befürchten, wenn Sie es vermeiden, zum Aufhängen perforierende Klammern zu verwenden. Hängen Sie dagegen den Film mit einer nur klemmenden Klammer sicher auf, können Sie erstaunliche Gewichte daran aufhängen. (Siehe Schleppseil-Anekdote oben.) Sie brauchen es aber nicht zu übertreiben. Hängen Sie nur eine nicht zu leichte Klammer daran, die verhindert, dass der Film sich beim Trocknen aufrollt. Mehr ist vermutlich nicht wirklich nützlich. Der Film wird vermutlich auch nach einer solchen "Hängepartie" immer noch nicht völlig plan liegen, v.a. neigt er in der Wärme eines Leuchttischs wieder zum Aufrollen.
Völlige Planlage erreicht man auch bei Polyesterträgern ohne Probleme, wenn die Filme zusätzlich zur Emulsionsschicht eine so genannte NC-Schicht (NC = non-curling) auf die Rückseite gegossen bekommen. Dass das nicht durchgängig passiert, liegt an zweierlei:
- sind die meisten Polyesterfilme (noch) etwas abartige Spezialitäten, die nicht für "normale" Fotografen bestimmt sind (etwa Mikrofilme und IR-Filme), sondern für besondere Anwendungen wie Verkehrsüberwachung (Starenkästen), Mikroverfilmung von Dokumenten, Luftaufklärung usw. Dabei ist die beschriebene Neigung des Films nicht von Bedeutung, aber die Stabilität des Polyesterträgers für die durchgängig maschinelle "Handhabung" des Films und die Archivierung unverzichtbar.
- kostet so ein zusätzlicher Guss fast genau dasselbe wie der Guss der eigentlichen lichtempfindlichen Schicht. Wer also nach plan liegendem Polyesterfilm ruft, muss ggf. bereit sein, diesen auch zu bezahlen, und das tun wir Fotografen nicht gerne.
Einen deutlichen Einfluss auf die Bockigkeit von Polyesterfilmen haben lt. MACO-Pressemitteilung die Netzmittel: Derzeit sollen nur zwei Netzmittel für Polyesterfilme optimiert sein und die Planlage unterstützen, und zwar LP-MASTERPROOF und Kodak Photo Flo. Denken Sie aber daran, dass beim Netzmittel nicht nach der Devise verfahren werden sollte: "Viel hilft viel." (Siehe auch Trocknen von Filmen) Ich selbst habe recht positive Erfahrungen mit Agfa Agepon gemacht.
Kaffee muss sich setzen – Pulverentwickler auch!
Die Antwort auf die alte Scherzfrage "Wer hat es bequemer: der Kaffee oder der Tee?" lautet bekanntlich "Der Kaffee, denn er darf sich setzen, während der Tee ziehen muss." Gleiches gilt bei Entwicklern, die Sie aus Pulver ansetzen:
Wer Pulverentwickler gleich verwendet, wenn er klar aussieht, sollte mit Überraschungen aller Art rechnen, zumindest aber mit punktförmigen Entwicklungsfehlern. Pulverentwickler sollte man in aller Regel nach dem kompletten Auflösen der Chemie, wenn er schon richtig schön klar aussieht, vor der Benutzung ein paar Stunden stehen lassen, am besten über Nacht. Erst dann ist man einigermaßen sicher, dass keine nicht aufgelösten Kristalle mehr drin suspendiert sind, die die besagten Pünktchen hervorrufen.
Überhaupt nicht empfehlenswert ist es, diesen Prozess durch langes und heftiges Rühren mit einem Magnetrührer oder einer ähnlichen Vorrichtung – oder noch schlimmer: durch Schütteln – beschleunigen zu wollen. Dabei wird so viel Luft in innigen Kontakt mit dem Entwickler gebracht, dass eine Menge Entwicklungsagenz oxidiert wird.
Vorrat von Wasser bei Raumtemperatur
Für die Vorwässerung, Entwicklung und das Wässern nach der Ilford-Methode benötigt man Wasser bei Raumtemperatur. Aus der Leitung kommt aber i.d.R. Wasser, dessen Temperatur im Jahreslauf zwischen 4 °C und 18 °C schwankt. (Mehr als 18 °C hatte ich selbst dieses Jahr nicht.) Aber die Temperatur der häuslichen Umgebung ist, von gelegentlichen Ausnahmen einmal abgesehen, in unseren Breiten doch recht konstant im Bereich um 20 °C. Was liegt also näher, als sich am Vorabend einer Entwicklungs-Session einen Kanister Wasser in die Ecke zu stellen? Am nächsten Abend haben Sie dann Wasser bei nahezu 20 °C, für alle Zwecke außer der Entwicklung selber jedenfalls hinreichend genau.
Wenn Sie nicht am Vorabend an die Bereitstellung denken möchten, empfiehlt es sich, immer einen Vorrat zu halten. Damit das Wasser nicht veralgt, ist ein lichtundurchlässiger Kanister empfehlenswert. Sollten Sie einen luxuriösen Metallbehälter nutzen, achten Sie darauf, dass es Edelstahl ist, damit sich keine Metallionen im Wasser lösen. Diese könnten insbesondere bei Verwendung des temperierten Wassers für Entwickleransätze zu unerwarteten Resultaten führen.
Entwicklung bei höheren oder tieferen Temperaturen
Manche Entwickler sind für höhere Temperaturen als 20 °C formuliert. Ein solches Beispiel ist LP-CUBE XS, der zwar herausragende Resultate bei Schärfe und Körnigkeit bringt, aber leider nur bei 24 °C und dann auch noch mit langen Entwicklungszeiten verarbeitet werden soll. Da wie oben erwähnt unsere gute Stube meist nur eine Umgebungstemperatur von 20 °C aufweist, sehen sich viele Fotografen, die nicht im Besitz eines temperierbaren Prozessors sind, außer Stande, solche Entwickler auszuprobieren.
Haben Sie einmal ausprobiert, wie lange es dauert, bis sich 1 l Wasser von anfänglich 24 °C in einer Umgebung mit 20 °C messbar abkühlt? Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine alte Kunststoff-Teigschüssel halb mit 24-grädigem Wasser gefüllt und das als Mantelbad für einen JOBO-Kipptank genutzt. Über die Entwicklungszeit von fast 30 min betrug die Abkühlung weniger als ¼ Grad! Damit kann man leben.
Sie sollten
- zur Verbesserung der Isolation lieber Kunststoffbehälter als Metallbehälter für das Mantelbad nutzen; ganz hervorragend sind Hartschaum-Elemente (besser bekannt als Styropor™), wie sie auch zur Verpackung verwendet werden.
- für eine möglichst innigen Kontakt zwischen Mantelbad und Tank und für eine kompakte Form des Mantelbades sorgen, also nicht den Tank in eine flache Schale mit Wasser stellen. Bei einer solchen Konfiguration steht der größte Teil der Außenfläche des Tanks "im Freien" und wird nicht temperiert, und das Wasser hat eine große Grenzfläche zur kälteren Umgebung, kühlt sich also schneller ab.
- ein nicht zu kleines Volumen nutzen. Bei größeren Volumina ist die Trägheit größer, und das Verhältnis von Oberfläche (Wärmeabgabe an die Umgebung) zu Inhalt (Trägheit) ist günstiger. 500 ml erscheinen mir ein vernünftiges Minimum für einen JOBO-Tank für zwei Filme.
- Natürlich funktioniert so ein Mantelbad auch zum Kühlen, wenn z. B. wie in diesem Sommer die Raumtemperatur ungemütlich hoch wird und die Entwicklungszeit schon bei 20 °C nur 5 min betrug.
Man kann natürlich auch mit Mut zum Risiko einfach den Entwickler etwas wärmer (kälter) als auf Solltemperatur in den nackten Tank füllen. Nach der Entwicklung ist er dann etwas kälter (wärmer), und die beiden entgegengesetzten Abweichungen gleichen sich hoffentlich aus. Das wird noch in einigen Büchern aus meiner fotografischen Anfangszeit empfohlen. Dazu müsste man aber ausprobieren, wie groß die Abkühlung/Erwärmung von z. B. 500 ml Entwickler über die gewünschte Zeit ist. Erwärmt sich der Entwickler bei 30 °C Außentemperatur innerhalb der Entwicklungszeit um 2 °C ab, müsste es gut hinkommen, wenn ich ihn statt mit 20 °C mit 19 °C in den Tank kippe. Dann müsste er ziemlich genau mit 21 °C herauskommen. Aber in der Zeit, die ich brauche, um das herauszufinden und die Lösung auf 19 °C zu temperieren, habe ich auch ein Mantelbad mit 20 °C angesetzt.
Knapp daneben: Entwicklungszeiten bei geänderter Temperatur
Ilford-Datenblätter sind zwar insofern vorbildlich zu nennen, als man dort genaue Anweisungen findet, wie die Entwicklungszeiten anzupassen sind, wenn man einmal nicht bei 20 °C entwickeln kann, doch finde ich die in den Datenblättern im Format einer Luxus-Briefmarke gedruckten Grafiken nicht nur wegen ihrer Größe furchtbar ungenau, sondern auch extrem anwenderunfreundlich. Dazu noch das "Loch" in der Grafik zwischen 6 und 8 sowie 8 und 10 Minuten...
Einfacher macht es eine Tabelle, wie ich Sie ihnen nachfolgend angebe. Die Quelle zu dieser Tabelle stammt, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, auch von Ilford. Ich habe Sie vor Jahren im Internet gefunden und von Grad Fahrenheit in Grad Celsius umgerechnet. Die Werte sind daher leicht gerundet.
In der Literatur (z. B. Haist, Modern Photographic Processing, oder Mason, Photographic Processing Chemistry) wird angegeben, dass nicht für alle Film/Entwickler-Kombinationen dieselbe Funktion für die Umrechnung von Soll-Temperatur auf Ist-Temperatur verwendet werden kann. Es werden aber mehr oder minder komplizierte Formeln angegeben, die oft funktionieren sollen. In meiner praktischen Erfahrung hat sich die nachfolgende Umrechnungstabelle (Sie hängt bei mir im Bad an der Wand.) verlässlich brauchbare Resultate liefert.
Die Tabelle benutzen Sie so: Suchen Sie sich in der Kopfzeile die Spalte mit der Soll-Temperatur (meist 20 °C), für die die Entwicklungszeit gilt. Wandern Sie in der Spalte nach unten, bis Sie zu der entsprechenden Zeit kommen. Gehen Sie dann seitwärts bis in die Spalte der tatsächlichen Temperatur. Die Zeit, die Sie dort finden, ist die angepasste.
| 18 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| 5 | 4 1/2 | 4 | 3 1/2 | 3 1/4 | 2 1/2 |
| 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | 3 3/4 | 3 |
| 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | 3 1/4 |
| 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 7 1/4 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 |
| 8 | 7 1/4 | 6 1/2 | 6 | 5 1/4 | 4 1/2 |
| 8 3/4 | 7 3/4 | 7 | 6 1/2 | 5 3/4 | 5 |
| 9 1/4 | 8 1/4 | 7 1/2 | 6 3/4 | 6 | 5 1/4 |
| 9 3/4 | 8 3/4 | 8 | 7 1/4 | 6 1/2 | 5 1/2 |
| 10 1/2 | 9 1/2 | 8 1/2 | 7 3/4 | 7 | 6 |
| 11 1/4 | 10 | 9 | 8 | 7 1/4 | 6 1/4 |
| 11 3/4 | 10 1/2 | 9 1/2 | 8 1/2 | 7 3/4 | 6 1/4 |
| 12 1/2 | 11 1/4 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 13 | 11 3/4 | 10 1/2 | 9 1/2 | 8 1/2 | 7 1/4 |
| 13 3/4 | 12 1/4 | 11 | 10 | 9 | 7 1/2 |
| 14 1/4 | 12 3/4 | 11 1/2 | 10 1/2 | 9 1/4 | 8 |
| 14 3/4 | 13 1/4 | 12 | 10 3/4 | 9 3/4 | 8 1/4 |
| 15 1/4 | 13 3/4 | 12 1/2 | 11 1/4 | 10 | 8 3/4 |
| 16 | 14 1/2 | 13 | 11 3/4 | 10 1/2 | 9 |
| 16 3/4 | 15 | 13 1/2 | 12 | 11 | 9 1/4 |
| 17 1/4 | 15 1/2 | 14 | 12 1/2 | 11 1/4 | 9 3/4 |
| 17 3/4 | 16 | 14 1/2 | 13 | 11 3/4 | 10 |
| 18 1/2 | 16 3/4 | 15 | 13 1/2 | 12 1/4 | 10 1/2 |
| 19 1/4 | 17 1/4 | 15 1/2 | 14 | 12 3/4 | 10 3/4 |
| 19 3/4 | 17 3/4 | 16 | 14 1/2 | 13 | 11 |
| 20 1/2 | 18 1/2 | 16 1/2 | 14 3/4 | 13 1/2 | 11 1/2 |
| 21 | 19 | 17 | 15 1/4 | 13 3/4 | 11 3/4 |
| 21 3/4 | 19 1/2 | 17 1/2 | 15 3/4 | 14 1/4 | 12 |
| 22 1/4 | 20 | 18 | 16 1/4 | 14 1/2 | 12 1/2 |
| 22 3/4 | 20 1/2 | 18 1/2 | 16 3/4 | 15 | 12 3/4 |
| 23 1/2 | 21 | 19 | 17 1/4 | 15 1/2 | 13 1/4 |
| 24 1/4 | 21 3/4 | 19 1/2 | 17 1/2 | 16 | 13 1/2 |
| 24 3/4 | 22 1/4 | 20 | 18 | 16 1/4 | 13 3/4 |
Beispiel:
Solltemperatur: 20 °C, Entwicklungszeit bei 20 °C: 11 min
Tatsächliche Temperatur: 19 °C, korrigierte Entwicklungszeit: 12 min 15 s
Dass zumindest bei intermittierender Bewegung eine Entwicklung bei 24 °C nicht einfach durch einen Faktor auf 20 °C umgerechnet werden kann, wird leicht klar: Durch die Veränderung der Zeit verändert sich bei Entwicklung hier das Verhältnis der Zeiten, während derer der Film bewegt wird und während derer er ruht. Der Unterschied ist allerdings kein großer, und ich würde annehmen, dass dieser Effekt nur bei kurzen Zeiten und seltener Bewegung eine wesentliche Rolle spielt.
Leichte Abweichungen sind aber immer drin, und ob die nun auf eine nicht ganz exakte Temperaturanpassung zurückzuführen sind oder auf die vorstehend beschriebenen Einflussgrößen, wird schwer zu klären sein. Wenn Sie also 100%ig reproduzierbare Resultate brauchen, bleibt Ihnen nur übrig, für 100%ig identische Bedingungen zu sorgen, also erforderlichenfalls zu kühlen oder zu heizen.
Verwenden Sie solche Tabellen nicht für beliebig große Korrekturen. Sie sollten also nicht mit einer solchen allgemeinen Tabelle von 24 °C auf 18 °C korrigieren (oder zumindest nicht erwarten, dass die Resultate stimmen), nur weil die Tabelle das hergibt. Tabellen, Formeln und auch Faktoren sind Näherungen, die nur für kleine Korrekturen gelten.
Luftoxidation von Entwickler
Zwar halte ich persönlich nicht viel von mehrfach zu nutzenden Entwicklern, speziell dann nicht, wenn man nur einen geringen Durchsatz hat, aber manch einer will aus diesem oder jenem Grund nicht von seiner Lieblingssuppe lassen. Für leber- und geschmacksbewusste gibt es so genannte Wine Saver®, Gummistopfen und zugehörige kleine Handpumpen, mit denen man Flaschen evakuieren kann. Dasselbe kann man auch mit Entwicklerflaschen machen, vorausgesetzt, die Flaschen sind aus Glas (Kunststoff beult sich unter dem Außendruck zusammen, wenn die Flasche evakuiert wird und ist zudem erstaunlich gasdurchlässig.) und der Stopfen passt. Von der Benutzung von Weinflaschen als Chemikaliengefäße rate ich ab. Aus gutem Grund ist die Lagerung von Chemie in Lebensmittelgefäßen eine ganz miese Praxis. Es gibt auch Glasflaschen, bei denen keine Verwechslungsgefahr besteht und in die die Stopfen passen.
Fixierbad-Recycling
Bei den Kapazitäten von Fixierbädern fällt auf, dass die Grenzwerte für den höchstzulässigen Silbergehalt bei Papierbädern viel niedriger liegen als bei Filmbädern (siehe z..B. Fixierbad). Man kann daher Bäder, die für Papier nicht mehr brauchbar sind, für Filme noch eine Weile nutzen. Ich empfehle das allerdings nur für das erste Bad einer Zweibad-Kaskade!
Niemals sollten Sie aber auf den Gedanken kommen, angebrauchtes Filmbad für Papier zu benutzen, selbst dann nicht, wenn der Silbergehalt noch gering ist. Warum nicht? Viele Filme, insbesondere solche mit Flachkristallen (Kodak T-max, Ilford Delta) und höherer Empfindlichkeit, enthalten Jodid. In dem vorstehend zitierten Artikel habe ich erläutert, wie Jodid den Fixierprozess behindert. Bei Papier können Sie nicht wie bei Film auf einfache Weise die Klärzeit bestimmen und so merken, dass ein Bad vielleicht trotz geringen Silbergehaltes (wg. hohen Jodidgehaltes) jenseits seiner Kapazitätsgrenze angekommen ist.
Film-Klebeband: Knibbeln, nicht reißen
Manche KB-Filme sind mit Klebeband an den Spulenkern gelebt, Rollfilme sind mit Klebeband auf das Schutzpapier geklebt. Vor einiger Zeit berichtete mir ein Leser (dessen Namen ich leider nicht mehr weiß und dessen Mail leider unauffindbar ist), er habe zur Untersuchung der Wirksamkeit seiner Wässerungsmethode durch ein Analytik-Labor Filmstücke analysieren lassen, und dabei sei Erstaunliches zu Tage gekommen: Manche der Filmstücke, alle aus demselben Film, wiesen eine um ein Vielfaches höhere Thiosulfat-Restkonzentration auf als andere. Der Schuldige war bald gefunden: Die Stücke mit der hohen Thiosulfat-Konzentration waren die, die beim Trocknen unterhalb des Klebestreifens gehangen hatten. Aus dem Film wässert das Thiosulfat schnell aus, aber aus dem papiernen Klebeband nicht. Wenn dann Restwasser aus dem Klebeband am Film herunterläuft und eintrocknet, kontaminiert es ihn.
Fazit: Klebeband nicht durchreißen, sondern möglichst vom Filmende komplett abknibbeln oder den Film vor dem Klebeband abschneiden. Wenn das alles nicht geht, sollten Sie wenigstens das mit Klebeband "behaftete" Ende vor dem Trocknen, besser noch vor dem Wässern, abschneiden oder wenigstens nach unten hängen.
Netzmittel
Gut Ding will Weile haben!
Setzen Sie Ihr Netzmittel nicht erst an, wenn Sie es brauchen! Beim Ansatz entsteht durch die Mischerei oft Schaum, und Dank großer Oberfläche und geringem Gewicht läuft er nur schlecht von der Filmoberfläche ab. Konsequenz: Er trocknet auf dem Film ein und hinterlässt Flecken. Ich habe mir deswegen schon vor Jahren angewöhnt, mein Netzmittel schon vor dem Entwickler anzusetzen. Auf die Weise hat evtl. entstehender Schaum mindestens ein Viertelstündchen Zeit zu zerfallen. Aber möglichst abgedeckt stehen lassen, damit wenig Staub hineinfällt.
Falsche Sparsamkeit
Netzmittel sollte man nur dann mehrfach verwenden, wenn hintereinander weg mehrere Filme verarbeitet. Es ist nicht für mehrfache Nutzung gemacht. Seine Kapazität, wenn man sie so nennen möchte, würde dafür sicher ausreichen (von oberflächenaktiven Stoffen reichen kleinste Mengen). Aber das Zeug wird schnell gammelig, und es sammelt Staub.
Wenn Sie 250 ml ansetzen und darin nacheinander vier Filme baden (Das mache ich oft.) klappt das prima. Aber aufheben bis zum nächsten Tag – nein danke.
Von der Praxis, Netzmittel mittels Sprühflaschen auf den Film aufzutragen halte ich wg. der unvermeidlichen Schaumbildung (s.o.) und der meist praktizierten längeren Lagerung des angesetzten Netzmittels gar nichts.
Hier lohnt überzogene Sparsamkeit m.E. kaum. Schließlich ist die Anschaffung einer Flasche Netzmittel für weniger als 5 Euro angesichts der Verdünnungen von 1+100 bis 1+1 000 für die meisten von uns schon fast eine mittelfristige Investition.
Schaum vor dem Mund durch Netzmittelreste?
Nein, ich rede nicht über die Gefahren, die entstehen, wenn man Laborgefäße auch für Nahrungsmittel verwendet. Das tut doch wohl niemand, der halbwegs klaren Verstandes ist, oder? Aber man kann schon Schaum vor dem Mund kriegen, wenn der Entwickler durch Netzmittelreste so schäumt, dass man beim Kippen der Dose den Eindruck hat, der Entwickler hätte gar keinen Platz mehr.
Keine Angst: Nach meinen Erfahrungen ist es nicht so schlimm. Auch mir ist das schon passiert, und die entsprechenden Filme wurden astrein entwickelt. Diese Erklärung für fehlentwickelte Filme habe ich eigentlich nur in der Anfangszeit im Zusammenhang mit Gigabitfilm gehört. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Herr Schain von SPUR seinem speziell auf den Agfa Copex Rapid (Gigabitfilm ist auch nichts anderes Agfa Copex Rapid, verkauft mit spezieller Chemie.) abgestimmten Entwickler gezielt Netzmittel zusetzt. Es kommt also sehr auf die Entwicklerzusammensetzung an.
In alten Büchern liest man mitunter sogar noch die Empfehlung, dem Filmentwickler eine winzige Menge Netzmittel (schlimmer noch: Spülmittel) zuzusetzen, um die Benetzung des Films zu beschleunigen und gleichmäßiger vonstatten gehen zu lassen. Ich würde das heute nicht mehr empfehlen. Zum einen waren die damaligen Filme robuster als ihre heutigen, hoch- und vielleicht teilweise überzüchteten Nachkommen. Zum anderen gehe ich davon aus, dass die Fotochemie-Hersteller über die letzten 30 bis 40 Jahre erheblich dazugelernt haben und ihren Entwicklern im eigenen Sinne alles zusetzen, was für eine gleichmäßige Entwicklung nötig ist.
Dennoch sollte man im Sinne einer reproduzierbaren und sauberen Arbeitsweise die Verschleppung von Chemikalien grundsätzlich vermeiden. Würde man die Filmspiralen nach der Schlusswässerung trocknen lassen, wäre ja alles prima. Sie wären dann mindestens so sauber wie ein gewässerter Film, sollten also per Definition richtig sauber sein. Aber das Netzmittelbad kommt danach, und – wie gesagt – winzige Spuren Netzmittel reichen, um eine Wirkung zu erzielen. Damit meine Spulen netzmittelfrei sind, verfahre ich wie folgt: Nach Entnahme des Films spüle ich die (zerlegten) Spulen und meine geliebte Salatschleuder (Trocknen) mit Wasser aus. Dann nutze ich die Schleuder als Schüssel, in der ich die benutzten Spulen mit Wasser bedeckt ein Weilchen liegen lasse. Nach einem weiteren Wasserwechsel sind die Spulen nach meinen Erfahrungen sauber.
Beim Tank stellt sich das Problem nicht, wenn man für das Netzmittelbad nicht denselben Behälter nutzt wie für die restliche Verarbeitung. Ich habe ein altes Tankunterteil, das ich nur noch für diesen Zweck benutze. In das Netzmittelbad tauche ich immer nur die nötigsten Dinge, will sagen: ausschließlich die Spulen mit den Filmen, nicht aber Spulenachse und anderes entbehrliches Zubehör. Die beste Kontamination ist nämlich die, die nicht stattfindet.
Einen Nachtrag zu diesem Artikel finden Sie im nächsten Kolumnenbeitrag.
Kleine Tipps, die das (fotografische) Leben erleichtern
Thomas Wollstein
November 2003
Teil 1: Bei der Aufnahme
Dieser Artikel stellt das zusammen, was die Engländer „Odds and Ends“ nennen, einen Haufen kleiner, von mir als nützlich betrachteter Tipps und Tricks, die einzeln nicht für eigene Kolumnenbeiträge reichen. Bestimmt gibt es noch viele weitere solche Tipps. Wenn Sie der Meinung sind, ich hätte etwas ganz Nützliches vergessen, schicken Sie mir eine
Haltung bewahren! (Wie lange belichtet wird aus der Hand noch scharf?)
Eigentlich sollte es sich schon herumgesprochen haben: Die so ziemlich unergonomischste Kamerahaltung, mithin auch die Kamerahaltung, bei der es am schwierigsten ist, überhaupt unverwackelte Fotos zu bekommen, ist die übliche mit der Kamera vor dem Gesicht. Die Kamera befindet sich am oberen Ende einer hin- und herpendelnden Konstruktion (Gemeint ist der Fotograf.), der in einer absolut unbequemen Haltung mit meist krummem Rücken und verkrampften Armen da steht. Verkrampfte Muskeln zittern, und so wundert es nicht, dass viele Kollegen z.B. mit einer Normalbrennweite wirklich scharfe Fotos nicht ab dem durch die bekannte Faustregel vorgegebenen Grenzwert von 1/60 s hinbekommen, sondern sicher erst ab 1/250 s.
Wie anders sieht das bei einem Schachtsucher aus, wie ihn z.B. meine alte Rolleiflex oder in Form des Displays meine modernere (allerdings auch schon wieder veraltete) Nikon Cooplix hat. Mit diesen beiden Geräten habe ich schon unerwartet scharfe Fotos mit Zeiten von 1/15 s frei aus der Hand geschossen. In einigen alten Büchern werden zu Recht für verschiedene Fotografierhaltungen unterschiedliche Grenzwerte für die längste ohne Stativ zu haltende Verschlusszeit angegeben. Für eine Kamera, die man vor dem Bauch hält, möglichst mit dem Trageriemen um den Hals, werden erheblich längere Zeiten angegeben als für eine Kamera vor dem Gesicht. Zwei Blendenstufen Unterschied sind gängig. Halten Sie den Trageriemen leicht gespannt, aber nicht so sehr, dass Sie anfangen zu zittern. Sie werden sehen, Sie kommen mit wesentlich längeren Zeit davon als sonst. Dass es nicht immer gut geht, ist klar, aber stabiler als die übliche Haltung ist diese allemal.
Ungünstig in Bezug auf mäßig lange Zeiten – ich meine 1/30 s und länger – sind einäugige Spiegelreflexkameras. Wenn wir „zielen“, passiert folgendes: Das Auge registriert im Sucher eine Abweichung von der Sollposition, und das Gehirn sagt dem Bewegungsapparat, was er zu tun hat, um das auszugleichen. Während der eigentlichen Belichtung ist aber bei einer einäugigen Spiegelreflexkamera das Sucherbild futsch, was bedeutet, dass die Korrekturinformationen fehlen. Abweichungen werden nicht mehr korrigiert. Daher wissen Available-Light-Profis schon lange, dass Sucherkameras i.Allg. sicherer bei solchen Zeiten zu halten sind. Helfen können Sie sich natürlich auch, indem Sie auch auf eine SLR (= Single-Lens Reflex oder einäugige Spiegelreflexkamera) einen Aufstecksucher packen und durch diesen zielen. (Leider sind Aufstecksucher aber meist nicht eben preiswert.)
Überhaupt ist „aus der Hand“ nicht gleich „aus der Hand“. Wenn Sie sich an einer Wand anlehnen, bringt das eine Menge Stabilität, ich würde schätzen, dass sich so mindestens eine Stufe länger aus der Hand halten lässt. Noch besser, wenn Sie statt Ihres Körpers gleich Ihre Kamera anlehnen. Ich habe schon Aufnahmen bis zu 1 s scharf hinbekommen, indem ich meine Kamera an eine Häuserwand oder einen Laternenpfahl gehalten habe. Und auf einer Mauer steht eine Kamera fast ebenso sicher wie auf einem Stativ. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihr gutes Stück keinen Kratzer bekommt, legen Sie ein Kleidungsstück, eine Plastiktüte (für Umweltbewusste tut’s auch ein Baumwollbeutel) oder ein Kleidungsstück darunter. Aber aufgepasst: Machen Sie’s nicht zu weich, sonst ist ein Teil des stabilisierenden Effekts wieder dahin. Zweck ist es ja, die Kamera unbeweglich zu machen, und auf einem weichen Kissen ist sie noch beweglich.
Gute Dienste kann ein so genanntes Tischstativ leisten. Je nach Konstruktion können Sie damit Ihre Kamera wesentlich freier (und im Hinblick auf Kratzer angstfreier) auf und an allen möglichen anderen Dingen anlehnen. Zu guter letzt lassen sich solche Stative auch nutzbringend als Schulter- oder Bruststative einsetzen.
Ein Stativ für die, die nicht gern schleppen: das Schnurstativ
Nachgerade genial ist das Schnurstativ. Ein erfindungsreicher Niederländer beschreibt unter http://www.xs4all.nl/~wiskerke/artikelen/touw.html das Touwtjesstatief (= Schnurstativ). Auch das ist eigentlich keine neue Erfindung, sondern wird schon seit Jahrzehnten in Fotobüchern gepredigt. Besorgen Sie sich einfach für ein paar Euro eine Stativschraube und befestigen Sie an dieser ein hinreichend langes Stück solider Kordel. Sie können die Schraube (meist ist sie aus weichem Aluminium) dazu durchbohren, oder Sie klemmen einfach das Stück Kordel mit der Schraube am Kameragehäuse fest. Bei der Aufnahme lassen Sie nun einfach das Stück Schnur auf den Boden hängen, treten mit einem Fuß darauf, spannen die Schnur leicht, nehmen Ihrerseits eine entspannte Haltung ein und los geht's. Sie werden staunen, was das bringt. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass so mit guter Erfolgswahrscheinlichkeit eine um den Faktor vier (entspricht zwei Blendenstufen) längere Zeit gehalten werden kann als freihändig.
Eine raffinierte Verfeinerung dieses Stativs ist das Schnur-Zweibein (siehe genannte Web-Seite): Benutzen Sie ein hinreichend langes Stück Kordel, dessen Enden Sie zusammengeknotet haben, so dass ein Ring entsteht. Der muss so groß sein, dass Sie mit beiden Füßen darin stehen können und die Kamera in angehobenem Zustand auch noch in den Kordelring passt. Sie erzeugen so ein Dreieck, an dessen unteren Ecken sich Ihre Füße und an dessen Spitze sich die Kamera befindet. Die Kamera hat jetzt noch weniger Bewegungsmöglichkeiten als beim einfachen Schnurstativ. Sie brauchen hierzu nicht einmal eine Stativschraube, denn Sie können einfach die Kordel über die Kamera legen. (Nur sauber und trocken sollte sie an der Stelle sein.) Auch hier gilt wieder: Kordel leicht spannen, sich selber möglichst weitgehend entspannen.
IR-Fotografie
Fehlersuche durch Kontrollaufnahme ohne Filter
Es ist eine der unvermeidbaren Tücken der IR-Fotografie, dass die Aufnahmen mit "Licht" gemacht werden, dass wir nicht sehen. Dieses Licht müssen wir, um richtig belichten zu können, auch noch messen. Viele Belichtungsmesser sind für IR ebenso blind wie ihre Besitzer, und wenn ein Belichtungsmesser IR misst, ist immer noch die Frage, worauf Sie damit zielen. Bleibt also nichts übrig, als den teuren und hochpräzisen Belichtungsmesser als grobes Schätzeisen zu verstehen und, wie es im Datenblatt zu Kodaks HIE heißt, „umfangreiche Belichtungsreihen“ durchzuführen. Dennoch misslingen IR-Aufnahmen oft, und dann möchte man, um nicht teuren Film für nichts verschwendet zu haben, wenigstens die Fehlerursache wissen. In diesem Zusammenhang möchte ich einen Tipp weitergeben, für den – so ein IR-Fotografenkollege, dessen Namen mir entfallen ist – Herr Schröder von MACO eines Tages in den Himmel kommen könnte:
Jeder IR-Film ist auch für sichtbares Licht empfindlich. (Das ist ja der Grund für die Filterei, siehe meine Beiträge zur IR-Fotografie unter IR-Fotografie-1, IR-Fotografie-2 und IR-Fotografie-3. Das lässt sich trefflich für eine Kontrollaufnahme nutzen. Nach einer Belichtungsreihe mit Filter nehmen Sie noch eine Aufnahme ohne Filter auf, wobei Sie den Film mit der Nennempfindlichkeit für sichtbares Licht belichten. Wenn Sie den Film dann entwickeln, kann Ihnen eine solche Kontrollaufnahme eine ganze Reihe von Fehlern aufzeigen, z. B. Unterentwicklung (Entwickler überlagert?), bestimmte Kamera-Fehlfunktionen usw. Eine solche Kontrollaufnahme ist wesentlich besser zu beurteilen als etwa die auf dem Filmrand einbelichteten Filmnummern.
Erfahrungsgemäß können Sie bei den gängigen IR-Filmen für ungefilterte Aufnahmen von folgenden Empfindlichkeiten ausgehen:
|
Film |
ungefähre Empfindlichkeit für sichtbares Licht |
|
Ilford SFX 2) |
200/24° |
|
Kodak HIE |
200/24° bis 400/27° |
|
Konica IR 750 |
50/18° |
|
MACO AURA 1) |
100/21° |
|
MACO CUBE 400c 2) |
400/27° |
|
MACO IR 750c |
100/21° |
|
MACO IR 820c |
100/21° |
|
1) Bei diesem Film handelt es sich um MACO IR 820c ohne Lichthofschutzschicht. Er ist nur als Planfilm und Rollfilm 120 verfügbar. |
|
Von der Küche in die Kamera: Alu-Folie als "IR-Lichtverstärker"
Eine unangenehme Konsequenz des Filterns mit undurchsichtigen oder fast undurchsichtigen Filtern besteht darin, dass die nutzbare Empfindlichkeit des Films in Bereiche abrutscht, die zwingend die Verwendung eines Stativs erforderlich machen. So hat z.B. ein MACO IR 820c, wenn man ihn zur Erzielung eines ausgeprägten IR-Effekts mit einen undurchsichtigen IR-Filter (z. B. RG 715) nutzt, nur noch eine effektive Empfindlichkeit um magere ISO 12/12° herum. (Die genaue effektive Empfindlichkeit hängt sehr vom gewünschten Effekt und der entsprechenden Entwicklung ab.) Selbst die (für einen IR-Film) wirklich hohe Empfindlichkeit des Kodak HIE schrumpftbei Verwendung eines 87er Filters auf Werte um ISO 50/18°. Daher war mein Staunen groß, als ich in einem auf IR-Fotografie spezialisierten Forum einen Thread unter der Überschrift "HIE bei ISO 1000" fand. Der Trick dahinter ist einfach: Bei einigen Kameras kommt es bei Verwendung von Kodak HIE zur Abbildung des Musters der Filmandruckplatte im Negativ. Das liegt daran, dass Licht durch den Film dringt, dank des Fehlens der Lichthofschutzschicht beim HIE auf die Andruckplatte trifft und von dieser zurück zum Film reflektiert wird. Abhilfe schafft bei einem solchen Problem oft ein Stück schwarzes Papier (z. B. das Schutzpapier von Rollfilmen), das über die Andruckplatte geklebt wird. (Probieren Sie aber aus, ob es damit nicht zu eng in der Filmführung wird! Es kann sein, dass der Filmtransport zu schwergängig wird.)
Die meist unerwünschte Reflexion an der Andruckplatte kann man aber auch verstärken und dann nutzen: Wenn Sie die Filmandruckplatte mit Aluminiumfolie überkleben, verstärken Sie die Reflexion. So richtig stark wird der Effekt nur bei den Filmen sein, die keine Lichthofschutzschicht aufweisen, also besagtem Kodak HIE und MACO AURA. (Bei den anderen Filmen verhindert die Lichthofschutzschicht, dass noch Restlicht die Andruckplatte erreicht.) Die Reflexion an der Folie führt zu einer Erhöhung der effektiven Empfindlichkeit und verstärkt die Halo-Effekte deutlich.
Bevor Sie in ungebremsten Jubel ausbrechen, bedenken Sie aber folgendes: Die Folie verstärkt nur den Kontrast (und damit die effektive Empfindlichkeit), nicht aber die echte (durch die Schattendichte bestimmte) Empfindlichkeit, denn schwaches Licht wird völlig von der Emulsion geschluckt und erreicht die Andruckplatte gar nicht erst. D.h. die Schattendichte wird durch die Alu-Folie nicht nennenswert zunehmen, also auch nicht die echte Empfindlichkeit. Aber im Ausgleich können Sie bei gleich starkem oder stärkerem Halo-Effekt kürzer entwickeln, was Ihnen feineres Korn einbringt.
Polaroid-Kamera im Eigenbau
Profis verwenden oft zur Kontrolle Ihrer Lichtführung ein Polaroid-Rückenteil. Nun passt ein solches nicht an jede Kamera, und nicht jeder will sich eine ausgewachsene Polaroid-Kamera leisten. Einen funktionierenden Ersatz kann man leicht mithilfe eines gebraucht erstandenen Polaroid-Rückenteils aus einer für'n Appel und 'n Ei erstandenen alten Rollfilm- oder Plattenkamera selber bauen. Mit etwas bastlerischem Geschick lässt sich das Rückenteil an eine solche alte Möhre ankleben.
Grüße von Herrn Schwarzschild
Bis hin zu Belichtungszeiten von 1 s ist ja alles prima: 1 Blendenschritt schließen = doppelt so lange belichten. Ab bei 1 s fängt es an, unangenehm zu werden. Man muss rechnen. Die Filmhersteller geben mitunter für ihre Filme in den Datenblättern Verlängerungsfaktoren an, die mir z.B. sagen, dass ich bei einer Zeit von 2 s nach Belichtungsmesser tatsächlich 4 s belichten muss, wenn ich 10 messe, tatsächlich 30 s usw. So weit, so gut. Was aber, wenn ich jetzt auch noch Belichtungsreihen aufnehmen möchte? (Denn die Messerei bei Nacht ist nicht ohne.) Dann muss ich für die Aufnahme mit Bl. 11, 4 s nach Belichtungsmesser mit einem anderen Faktor verlängern die mit Bl. 11, 8 s. Einfacher wird’s, wenn man statt einer Zeit-Belichtungsreihe eine mit Hilfe der Blende aufnimmt: Ich rechne einmal aus, dass die 4 s nach Schwarzschild-Korrektur vielleicht 10 sind, danach belichte ich mit Bl. 11, 4 s, Bl. 8, 10 s und Bl. 5,6, 10 s. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich die Schärfentiefe nicht brauche. Ist Bl. 11 zwingend erforderlich, bleibt nur die Rechnerei.
Ein weiterer Pferdefuß bei den langen Belichtungen (der auch dafür spricht, die Blende zu öffnen, und nicht die Zeit zu verlängern) liegt darin, dass die Filme zur Aufsteilung neigen. Die Schatten sind möglicherweise längst im Bereich so schwacher Belichtungen, dass der Schwarzschild-Effekt in voller Stärke zuschlägt, aber die Lichter liegen noch im Bereich „ziviler“ Belichtungen. Dann werden bei der Schwarzschild-korrigierten Belichtung die Lichter ziemlich überbelichtet. Die meisten Langzeitaufnahmen profitieren daher von einer ausgleichenden Entwicklung.
Wenn Sie übrigens die Datenblätter z.B. von Ilford anschauen, werden Sie vielleicht bemerken, dass die angegebenen Schwarzschildkorrekturen für alle Filme, vom Pan F bis hin zum Delta 3200 dieselben sind. Kodak macht es ähnlich. Das – das wurde in einem Artikel in der Photo Techniques dieses Jahr an Beispielen nachgewiesen – ist nicht korrekt. Moderne Filme haben dünnere Schichten als ältere, und das ist möglicherweise der Grund dafür, dass die Schwarzschild-Korrekturen bei modernen Filmen viel kleiner ausfallen als bei den Vorläufern. Eindrucksvoll demonstriert das Fuji mit dem Neopan 100 ACROS, der bis einschließlich 2 min (!) Belichtungszeit keine Korrektur benötigt. Betrachten Sie solche Tabellen also nur als Orientierung, nicht als exaktes Wissen. Dass die Filmhersteller damit wegkommen, liegt nur daran, dass aufgrund der nicht ganz einfachen Messsituation kaum ein Fotograf mit Bestimmtheit zu sagen vermag, dass der Fehler beim Filmhersteller lag und nicht bei ihm selber.
Sind wir Fotografen PISA-gefährdet?
Wo gibt es noch anspruchsvolle Fotobücher?
Thomas Wollstein
Oktober 2003
Was tut der Esel, wenn’s ihm zu gut geht? Er begibt sich auf’s Eis. Mir geht’s genau so. Wann immer ich einmal eine Zeit lang keine Prügel für meine Kolumne bekomme, fängt es an mich in den Fingern zu jucken und ich muss mal wieder einen Artikel schreiben, bei dem ich weiß, dass ich mich bei den „lieben Kollegen“ sicher nicht allzu beliebt machen werde.
Also denn: Es wird um den heutigen Zustand der Foto(fach)literatur gehen.
Wenn ich in meinen Lieblingsbuchladen gehe, einen mit einer Riesenauswahl zu praktisch allen Themen, die die Welt bewegen, dann finde ich in der Hobbyabteilung ein paar (wenige) Meter Regal, in denen viele schöne großformatige, optisch sehr ansprechende Bücher stehen. Das Thema des einen oder anderen mag mich ansprechen, und ich nehme das Buch in die Hand, um zu sehen, wie denn der Autor das Thema angeht und – vor allem – wie tief er einsteigt. Meist sehe ich schnell:
- Der Autor kann fotografieren. Die Bilder sind technisch in Ordnung.
- Manche Autoren können sogar lesbare Texte schreiben.
Aber jetzt kommt’s:
- Das technische Niveau der Bücher kommt nicht über fotografisches Grundschulniveau hinaus.
In der Einleitung zu „Eine kurze Geschichte der Zeit“ schrieb Stephen Hawking, sein Verleger habe ihn gewarnt: Jede Formel halbiere die potenzielle Leserschaft. Trotzdem, so Hawking, habe er nicht 100%ig widerstehen können, welche aufzunehmen.
Inzwischen haben die Verleger sich weiter durchgesetzt: Es gibt kaum ein (deutschsprachiges) Buch, in dem etwas enthalten ist, das auch nur nach anspruchsvoller Technik riecht.
Als regelmäßige Leser kennen Sie meinen Standpunkt hierzu. Das Zitat von Hurter und Driffield, den „Erfindern“ der Schwärzungskurve, welches ihn sehr schön zusammenfasst, habe ich für den Beitrag über Sensitometrie (Schwärzungskurve) verbraucht. An dieser Stelle zitiere ich daher aus einem neueren Werk (Jenni Bidner: „The Lighting Cookbook“):
„Fotografie ist eine interessante Mischung aus reiner Kunst mit Technik und Wissenschaft. Jeder hat irgendwann einmal Glück, aber wenn Sie nicht um das »Wie« und das »Warum« Ihrer Ausrüstung, Ihrer Filme und der Beleuchtung wissen, wird erfolgreiche Fotografie für Sie ein Glücksspiel bleiben.“
Vor einiger Zeit fragte ich Tim Rudman, den Autor des „Master Photographer’s Lith Printing Course“, warum es sein Buch – es ist m.W. das einzige, das das Thema in dieser Gründlichkeit behandelt – nicht auch in einer deutschen Ausgabe gebe. Die Antwort war für mich erschreckend: Sein Verlag hatte es einem deutschen Verlag angeboten, aber der hatte mit der Begründung „too many words“, sprich: zu viel Text, abgelehnt. Zu viel Text in einem Buch, das mehr als nur reichhaltig bebildert ist, das didaktisch gut geschrieben ist und einen wirklich praxisorientiert in das Verfahren einführt?
Zweites Erlebnis in dieser Richtung: Auf der Photokina 2002 traf ich am MACO-Stand Frances Schultz, die mit ihrem Mann Roger Hicks eine Menge Bücher über Fotografie veröffentlich hat, von denen ich einige mit großem Vergnügen und Gewinn gelesen habe. Sie berichtete, dass Roger und sie vor kurzer Zeit ein Projekt geschmissen hätten, weil ihnen die Grafiker diktieren wollten, welche Bilder sie zu verwenden hätten. Dabei seien die technischen Punkte, die sie hatten illustrieren wollen, unter die Räder gekommen. Konsequenz: Das Buch konnte nicht erscheinen.
Da kommt einem unwillkürlich der Gedanke: „Halten diese Verlagsfritzen uns eigentlich alle für Analphabeten?“ Sollen wir nur noch Fotografie-Comics „lesen“?
Bei den Zeitschriften sieht es ähnlich düster aus. Wer in seinem Fachgebiet etwas genau wissen und auf dem Stand der Technik bleiben will, kommt normalerweise um Fachzeitschriften nicht herum.Fachzeitschriften sollten einem nach meinem Verständnis das Fach nahe bringen.
Was tun unsere Zeitschriften? Sie veröffentlichen Tests ohne Ende: Kameratests, Filmtests, neuerdings auch Softwaretests. So weit, so gut, man muss ja auch die kennen, aber das wäre m.E. eher etwas für eine Zeitschrift namens „Foto-Test“.
Portfolios bekannter Fotografen kommen auch zuhauf, d.h. wieder schöne Bilder. „Harte“ Technik wird man ganz vergebens suchen. Die ist wohl uncool.
Tja, wer trägt die Schuld?
Die Verlage „tun’s für Geld“, d.h. sie veröffentlichen, was sich verkauft, bzw. was ihre Zeitschrift finanziert. Offenbar ist es nicht möglich, in Deutschland für ein technisch orientiertes Buch oder eine technisch orientierte Zeitschrift hinreichende Absatzzahlen zu erzielen. Das wären dann nicht die Verlage, sondern wir Schuld!
Offenbar sind aber „wir“, d.h. Fotografen, die Wert auf praxisorientierte, technisch solide Lektüre Wert legen, nur eine kleine Minderheit.
Also?
Glück hat, wer des Englischen mächtig ist. Der englischsprachige Markt ist größer, und so findet man dort (noch?) Bücher, die nicht ganz dem Fluch der schönen Bilder anheim gefallen sind. Aber auch da ist der beschriebene Trend (s. Hicks/Schultz) zu verzeichnen.
Braucht man denn Technik?
Es gibt viele Fotografen, die mit Technik angeblich „nix am Hut haben“, die aber hervorragende Bilder machen. Ein berühmtes Beispiel ist Henri Cartier-Bresson, der von sich immer wieder behauptet haben soll, er verstehe nichts von Fototechnik. In meinen intoleranten Momenten sage ich zu so etwas nur „Humbug!“ Wenn ich toleranter bin – oder politisch korrekt? – formuliere ich es so: Henri Cartier-Bresson (und andere gute Fotografen, die ähnliches von sich behaupten) hat schlichtweg so viel fotografiert, dass ihm die Technik auf unbewusste Weise ins Blut übergegangen ist. Er fotografiert, wie er atmet, ohne bewusst denken zu müssen. Er ist sich keiner Technik-Kenntnisse bewusst, weiß aber „einfach so“, was geht und was nicht. Ganz so, wie ein Eisläufer nicht den Drehmoment-Erhaltungssatz kennen muss, um eine Pirouette drehen zu können. Alexander Spoerl, Autor des vor 40 Jahren veröffentlichten Buchs „Mit der Kamera auf du“, drückte das so aus: Man möge, um ein guter Fotograf zu werden, viel fotografieren und wenig abziehen.
Nun gibt es aber verschiedene Weisen zu lernen: Die einen lernen über den Kopf. Sie müssen die Technik als Technik angeboten bekommen, in Form von Büchern, Zeitschriften, Mails, Diskussionen. Die anderen lernen durch Tun. Sie halten es einfach so, wie von Alexander Spoerl vorgeschlagen.
Am Ende sind aber konsistent gute Bilder (statt Glückstreffer) nur dann möglich (s. Jenni Bidner), wenn Technik und Gestaltung stimmen.
Unlängst bekam ich von einem Leser eine sehr schmeichelhafte Zuschrift, in der er mir die Anregung gab, die Leser doch einmal in meinen Bücherschrank schauen zu lassen. Das ist es in der Tat, worauf diese lange Vorrede abzielte. Ich werde Ihnen nachfolgend ein paar Fotobücher vorstellen, die ich gelesen habe und „meinen Senf dazu abgeben“, mal positiv, mal weniger positiv.
Es ist aber nur ein Blick in eine Ecke meines Bücherschranks. Ich lese seit über 25 Jahren Fotobücher, und ich lese schnell und viel. Entsprechend stehen in meiner Bibliothek Unmengen an Fotobüchern. Ich bin nämlich ein Mensch, der trotz seines schnellen Lesetempos eher langsam lernt. D.h. Lesen ist nicht Umsetzen. Vorher muss ich probieren, manches auch mehrfach lesen, bis ich es kapiert habe, und das dauert eben. Macht aber nix. Fotografieren ist mein Hobby. Da macht es nichts, wenn ich länger brauche, um neu erworbene Weisheiten umzusetzen.
Einige der genannten Bücher werden Sie in Ihrem Buchladen mit Sicherheit nicht finden können, weil sie nämlich inzwischen vergriffen sind. Aber es gibt zwei Web-Sites, die ich Ihnen ans Herz lege, wenn Sie nach vergriffenen (nicht nur) Fotobüchern auf die Jagd gehen wollen: www.zvab.com (Zentralverzeichnis Antiquarischer Buchläden) und www.abebooks.com (letztere Adresse bietet auch Internationales).
Viele der Bücher sind aus den genannten Gründen leider nur in englischer Sprache zu haben. Ich hoffe einfach einmal, dass das für die meisten interessierten Leser kein Problem ist.
Ob mir ein Buch gefällt oder missfällt, ist natürlich auch eine Geschmacksfrage.
Ach ja: Zu guter Letzt möchte ich Ihnen natürlich noch eine ganz hervorragende Informationsquelle ans Herz legen. Sie ahnen es? Es geht natürlich um meine Kolumne...
Ein Blick in Wollsteins Fotobücherregal
Die unten aufgeführten Bücher sind eine Auswahl von Büchern, die ich gelesen habe, eingeschränkt auf Themen aus dem Bereich Belichtung, Filmverarbeitung und Vergrößern, um die Sache handhabbar zu halten (und es mir zu gestatten, gelegentlich auch noch einmal einen Artikel zu den Büchern über die verbleibenden Teilbereiche zu verfassen). Die Sortierung der Bücher ist – wie mein überquellendes Regal – weitgehend vom Zufall bestimmt (hier: alphabetisch nach der ersten Spalte der Tabelle). Bestimmt gibt es noch viele gute Bücher zu entdecken.
|
Autor |
Titel usw. |
Kommentar |
|
Andreas Weidner |
Workshop Zonensystem (vergriffen) |
Schöne Bilder, aus meiner Sicht etwas steril. Ich empfand den Text als völlig überzogen und für Anfänger abschreckend. Ich habe genug hervorragende Riesenbilder von KB-Negativen gesehen, die den Vergleich mit Weidners Bildern nicht zu scheuen brauchen, um die Behauptung, dass man von KB nur bis 13/18 vergrößern könne, ins Reich der Fabel verweisen zu können. Mir geht es einfach auf den Nerv, wenn immer wieder behauptet wird, nur Großformatfotografie sei ernst zu nehmen. Das Werkzeug macht nicht die Bilder, der Fotograf tut es. |
|
Ansel Adams |
(The Camera) |
Dazu gibt’s kaum viel zu sagen. Klassiker der Fotografie, die auf jeden Fall lesenswert sind, aber heute kein Muss mehr.(Die Kamera) steht in Klammern, da sie zu dieser Auswahl eigentlich nicht passt; das Buch ist nur der Vollständigkeit halber erwähnt. |
|
Barry Thornton |
Edge of Darkness |
Technik verpackt in Anekdoten. Lesbar, verständlich, klar. Empfehlenswert. |
|
Carson Graves |
Elements of Black-and-White Printing |
Viel interessante Information zu Grundlagen des SW-Vergrößerns, aber leider mitunter nicht sehr klar strukturiert. |
|
Ctein |
Post Exposure |
Ein Buch von einem Fan Richard J. Henrys, gleichermaßen solide Methodik, gut erklärt, humorvoll. (Anmerkung: Jetzt vom Autor als kostenloses eBook) |
|
Eddie Ephraums |
Gradient Light – The Art and Craft of Variable-Contrast Printing |
Während es Leute gibt, die von diesem Buch (und anderen desselben Autors) total begeistert sind, fand ich sie nur schrecklich. Seite um Seite von Beispielen, wie technisch bescheidene Negative durch umfangreichste Nachbelichtungen und Abhaltereien gerettet wurden. Völlig überholte Technik (langsame Fixierung und ewiges Waschen) usw. Keine Empfehlung wert! |
|
Grant Haist |
Modern Photographic Processing I & II |
Das Referenzwerk für den ernsthaft an Fotochemie Interessierten. Für alle anderen abschreckend. Auch wenn das Buch nicht mehr ganz neu ist: Die Inhalte sind hinsichtlich klassischer Silberfotografie nach wie vor aktuell. |
|
Henk Roelfsema |
Zonensystem |
Nichts gegen trockene Kost, aber bei mir ist hier der Funke nicht übergesprungen. Ich habe die Bücher als praxisfern empfunden. |
|
Larry Bartlett & Jon Tarrant |
Workshop SW-Printing |
Hier wird auf vernünftige Weise – ganz anders als bei Ephraums – gezeigt und erklärt, was ein Master Printer wie aus einem Negativ holen kann. Empfehlenswert. |
|
Peter Fischer-Piel |
Das Zonensystem I & II |
Als Einführung ins Zonensystem habe ich Teil I nicht schlecht gefunden. Aber Sie kennen ja meine Meinung zum Zonensystem bei der KB-Fotografie. (Falls nicht, s. Eintesten von Film/Entwickler-Kombinationen) |
|
Ray Spence & Tony Worobiec |
Monochrom und andere Kunst-Printing-Techniken |
Eine völlig misslungene Übersetzung für den englischen Titel „Beyond Monochrome“. Zum Experimentieren anregende Bilder, aber technisch etwas oberflächlich. |
|
Richard J. Henry |
Controls in Black-and-White Photography |
Ein MUSS für den Test-Fanatiker. Hier wird beschrieben, wie man mit wisschenschaftlicher Methodik nachvollziehbar testet und seine Schlüsse daraus zieht. Gerade weil ich nicht gerne teste, fand ich dieses Buch klasse, denn so teste ich wenigstens nicht sinnlos! |
|
Roger Hicks & Frances Schultz |
Perfect Exposure |
Voller technischen Wissens, aber so geschickt verpackt, dass Sie gar nicht merken, dass Sie etwas lernen. Praxisorientiert. Hilfreich. |
|
Stephen Anchell |
The Variable-Contrast Printing Manual |
Ein klasse Buch über das Vergrößern auf Kontrastwandelpapier. Etwas trocken, aber gut erklärt. |
|
Stephen Anchell & Bill Troop |
The Film Developing Cookbook |
Für die, denen Grant Haist zu weit geht. Informationen zu gängigen Entwickleragenzien, Stärken und Schwächen bestimmter Entwickler. |
|
Tim Rudman |
The Photographer's Master Printing Course |
Zwei absolut lesenswerte Bücher. Mehr Technik als in Bartlett und Tarrant, aber gut erklärt und praxisorientiert. |
|
William Crawford |
The Keepers of Light |
Stilgeschichte der Fotografie und alte Printing-Techniken. Mir hat dieses Buch zu verstehen geholfen, wie Stil und Ausdruckmittel zusammenwirken. Regt zu eigenen Experimenten an. |
Nicht im Einzelnen genannt sind Bildbände anerkannt guter Fotografen wie
- Henri Cartier-Bresson
- Walker Evans
- Elliot Erwitt
- Andreas Feininger
- Lewis W. Hine
- August Sander
- Walter Vogel
- Edward Weston
um nur ein paar zu nennen, die mir spontan einfallen. Aus meiner Sicht lohnt es, sich solche Bildbände zu Gemüte zu führen und zu versuchen, Bilder, die einem gefallen, auch nachzuahmen. Schließlich haben eine ganze Reihe der großen Meister ihr Können erlangt, indem sie für ihren Lehrer in dessen Stil, d.h. nach Vorgabe, malten. Damit wird man nicht z. B. ein zweitklassiger Feininger, sondern man lernt, wie man gezielt auf bestimmte Resultate hin arbeitet, also elementares Handwerkszeug. Wenn man die Tricks kennt, kann man sich immer noch künstlerisch emanzipieren, dann mit einem guten Repertoire an Ausdrucksmitteln.
Zeitschriften
Nur eine lese ich (noch) regelmäßig, nachdem es die gute alte Foto Hobby Labor nicht einmal mehr als Beilage in der Color Foto gibt. Sie wurde durch ein regelmäßig erscheinendes Erotik-Portfolio ersetzt. Nichts gegen Erotik an sich, doch es stimmt schon traurig, wenn das letzte Bisschen technischer Substanz weichen muss, weil die Leserzahlen nur stimmen, wenn genug Nacktes enthalten ist. Es erinnert stark an eine bekannte deutsche Tageszeitung, die angeblich niemand liest, die aber eine immense Auflagenhöhe hat, und die sich durch groß gedruckte, eingängige Schlagzeilen und wenig bekleidete junge Damen auf der Titelseite auszeichnet.
Diese eine ist die Photo Techniques (USA). Dort gibt es noch eine Fotochemie-Kolumne und andere niveauvolle technische Beiträge (inzwischen eingestellt).
Black-and-White Photography, die vor ein paar Jahren ins Leben gerufene englische Zeitschrift aus der GMC (Guild of Master Craftsmen) Group, schien mir anfangs auch noch lesenswert, zumindest aber wegen der guten Bilder betrachtenswert und anregend. Die Artikel waren leider immer schon mehr Human Interest, d.h. Smalltalk. Nachdem ich zum x-ten Male in der Kolumne von Julien Busselle las, dass seine Interpretation eines als schwierig empfundenen Lesernegativs die einzig wahre sei, aber teilweise gefunden hatte, dass mir die Interpretation des Lesers besser gefiel, und nachdem ich in den Artikeln nichts lernte, flaute mein Interesse ab. Es kam noch hinzu, dass ich in zwei Ausgaben sachliche Fehler entdeckt hatte, auf die ich die Redaktion per Mail mit ausführlicher Erklärung zur Richtigstellung hingewiesen habe. Es kam keine Reaktion, keine Richtigstellung, nichts. An meinem Englisch kann’s eigentlich nicht gelegen haben, nur am Desinteresse der Empfänger.
Die deutsche Schwarzweiss, vierteljährlich erscheinend und wirklich sauteuer, habe ich hin und wieder gekauft oder in meiner Stadtbücherei angeschaut. Der eine oder andere Artikel fing viel versprechend an, endete aber immer da, wo es wirklich interessant wurde. Die Bilder sind in hervorragender Qualität gedruckt, nur oft für meinen naiven Geschmack nicht verständlich. Daher empfehle ich diese Zeitschrift nur sehr eingeschränkt und nicht im Abo.
Das Letzte
Leider habe ich bisher in keinem Buch lesen können, mit welchem sagenhaften Entwickler man die bei Harry Potter erwähnten Fotos bekommt, in denen sich die abgebildeten Personen bewegen. (Das war aber kein Kriterium, welches zur Abwertung von Büchern geführt hat.)
Ein paar Linien mehr machen noch keine Großformatqualität
Was bringen Mikrofilme in der bildmäßigen Fotografie?
Thomas Wollstein
August/Sept. 2003
Vorrede (dürfen Sie überspringen, ist nur Historie)
Was war das noch für ein Trubel, als die erste Hochauflösungsfilme auf den Markt kamen! Von der Revolution in der Fotografie war die Rede, von Großformatqualität vom KB-Negativ, vom schärfsten Film aller Zeiten usw.
Nach anfänglicher Goldgräberstimmung ist inzwischen wieder etwas Ruhe eingekehrt. Es hat sich gezeigt, dass mit Hochauflösungsfilmen zwar ganz hervorragende Bildqualitäten zu erreichen sind, dass aber längst nicht jeder damit glücklich sein kann. Ich wurde durch einen Zufall auf die nicht besonders aggressiv beworbenen Produkte von Herrn Schain aufmerksam, speziell den Agfa Copex Rapid, einen eigentlich nicht für bildmäßige Anwendungen gedachten Mikrofilm, mit SPUR Nanospeed Chemie. Ich bekam ein paar Testmuster, probierte Agfa Copex Rapid mit SPUR Nanospeed aus und war begeistert. In jüngerer Zeit hat Herr Schain einen weiteren Zaubertrank für die Hochauflösung ersonnen, den Entwickler SPUR Imagespeed, der zusammen mit einem anderen Mikrofilmmaterial einen weiteren Schritt nach vorn darstellen sollte.
Schon bei der Paarung Agfa Copex Rapid/SPUR Nanospeed behaupteten einige Kritiker, das sei doch alles Humbug. Schon ein Ilford Delta 100 würde bei richtiger Aufnahme und Verarbeitungstechnik mehr leisten als die besten Objektive hergeben würden. Was sollte da ein noch „besseres“ Verfahren liefern? Die Recherchen zu dieser Frage haben mir eine ganze Reihe von grundsätzlichen Sachverhalten klar gemacht, über die ich mir bisher wenig Gedanken gemacht hatte. Meine Einsichten in dieses Gebiet verdanke ich der Lektüre von Artikeln von Herrn Schain, Gesprächen mit ihm sowie Experimenten mit Filmen, die er mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Es ist daher nicht mehr als recht und billig, denke ich, wenn ich seine Produkte als Aufhänger für diesen Artikel wähle, an dessen Ende Sie sich, so hoffe ich, selbst ein Bild machen können, was Hochauflösung Ihnen bringen könnte.
Was ist ein „Hochauflösungsfilm“?
Die heutigen Standardfilme haben schon ein Auflösungsvermögen, das die meisten Fotografen nicht auskosten (können). Die Spitzenreiter bei den konventionellen Filmen sind:
|
Film |
Auflösungsvermögen bei Kontrast 1:1000 |
|
MACO PO 100c |
260 lp/mm |
|
Kodak T-max 100 |
200 lp/mm |
|
Anmerkung: Bei dem in manchen Zeitschriftenartikeln für den Fuji Neopan 100 ACROS angegebenen Auflösungsvermögen von 400 lp/mm muss es sich nach meinem Verständnis (und dies wird durch andere bekräftigt) um einen Mess- oder Druckfehler handeln. Selbst Fuji behauptet im Datenblatt [4] für den Film nicht mehr als 200 lp/mm. |
|
Aber was bedeuten diese Zahlen?
Die Frage, die man sich praktischerweise stellen muss, ist doch die:
Was schränkt die Auflösung des Gesamtsystems Objektiv – Film ein?
Gute moderne Optiken bringen es auf ein Auflösungsvermögen von rund 500 lp/mm unter optimalen Bedingungen, d.h. insbesondere bei einem Kontrast von 1:1000. Dabei geht es allein um die optische Leistung, Fehler wie Verwacklung usw. sind nicht das Thema.
Auflösung vs. Schärfe
Die Begriffe Auflösung und Schärfe werden oft durcheinandergeworfen. Wie in meinem Artikel über die Optimierung der Schärfentiefe in Landschaftsaufnahmen (Schärfentiefe und Auflösung, Bild 3) erläutert, sind die beiden Begriffe zu trennen. In [1] legt Ctein dar, dass für den Schärfeeindruck eines aufgelösten Linienpaars eine um den Faktor drei höhere Auflösung erforderlich ist als allein für die Tatsache, dass das Linienpaar aufgelöst wird.
Dies ist aber auch höchstens die Hälfte der Wahrheit. Für Filme angegebene Nennwerte der Auflösung gelten zunächst für einen Kontrast von 1:1000. D.h. der Kontrast zwischen dem Schwarz der Linie und dem Weiß des Hintergrundes beträgt 1:1000 oder – das ist für uns Fotografen anschaulicher – rund 10 (!) Blendenstufen. Herr Schneege von Ilford nannte mir als Daumenregel, dass man für die meisten praktischen Fälle mit etwa der Hälfte der Nenn-Auflösung rechnen kann. Tatsächlich geht es uns bei praktischen Aufnahmen aber in aller Regel darum, Details aufzulösen, bei denen zwischen „Hell“ und „Dunkel“ innerhalb eines Bereichs im Bild nur geringe Helligkeitsunterschiede vorliegen. Dies gilt insbesondere für die so wichtige Schattenzeichnung.
Kontrast: En Gros
Mikrofilmmaterial ist zunächst zur Ablichtung von Dokumenten gedacht und verhält sich daher auch sehr ähnlich wie Dokumentenfilm. Filme wie der nicht mehr angebotene Agfaortho 25 und sein Nachfolger MACO Ort 25c weisen eine extrem steile Schwärzungskurve auf, da normalerweise nur von ihnen verlangt wird, möglichst trennscharf zwischen Schwarz und Weiß zu unterscheiden. Für die bildmäßige Fotografie, wo es auf stetige Tonwertabstufungen ankommt, sind sie nur zu gebrauchen, wenn man sie mittels speziell formulierter kontrastmindernder Entwickler (z. B. SPUR Dokuspeed, LP-DOCUFINE LC, Tetenal Neofin Doku) zähmt.
Wir reden an dieser Stelle über den Globalkontrast, d.h. darüber, wie der Film „im Großen“ Helligkeitsunterschiede umsetzt. Beschrieben wird der durch die Schwärzungskurve bzw. den Gradienten. Wichtig für die Auflösung von Details in Fotos ist aber insbesondere der Detailkontrast, das Verhalten des Films bei der Umsetzung von Helligkeitsunterschieden im Kleinen.
Kontrast: En Détail
Von Detailkontrast reden wir in den Bereichen hoher Auflösung. Machen Sie mit mir ein Gedankenexperiment: Wir betrachten zwei (hier recht dicke) schwarze Linien auf weißem Grund. Die beiden Linien sind ein Stück weit auseinander. Zwischen den Linien ist dann ein weißer Bereich. Jetzt rücken wir die Linien immer weiter zusammen. Was passiert? Irgendwann ist der weiße Bereich von jetzt auf gleich „weg“. Aber bis zu diesem Zeitpunkt vorher war er noch rein weiß. Im Idealfall zweier wirklich scharfer Balken gibt es nur die Zustände „weißer Zwischenraum“ und „kein Zwischenraum“, nichts sonst.
Jetzt machen wir dasselbe mit zwei unscharfen schwarzen Linien. Wenn wir die immer näher zusammenbringen, fangen die Unschärfen irgendwann an, zu überlappen. Der Bereich zwischen den Linien ist ab dem Moment nicht mehr weiß, sondern grau. Das veranschaulicht Bild 1.
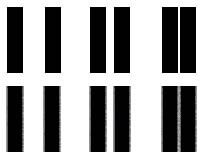
Bild 1: Zur Veranschaulichung der Modulationsübertragungsfunktion (MTF)
Wir betrachten nun den Kontrast zwischen dem Bereich zwischen den Linien und den Linien selbst. Bei ideal scharf berandeten Linien sei dieser Kontrast – Weiß zu Schwarz – 100%. Er bleibt in unserem Experiment bei den scharfen Linien bis zuletzt 100%, weil wir die Linien als ideal scharf berandet angenommen hatten.
Bei den unscharfen Linien nimmt der Kontrast schon ab, bevor die Linien zusammenstoßen. Die Unschärfebereiche überlagern sich, und statt weiß/schwarz haben wir grau/schwarz, deutlich weniger als 100%.
Man sieht, glaube ich, ganz intuitiv ein, dass der Zwischenraum zwischen den beiden unscharfen Linien schon früher „verschwunden“ sein wird als der zwischen den scharfen Linien.
Das Pendant der im Bild simulierten Unschärfe ist die Konturenschärfe in einem Film. Kein Film hat eine ideal 100%ige Konturenschärfe. Es ist sogar so, dass Mikrofilme aufgrund der Tatsache, dass sie für diesen Zweck eigentlich nicht gemacht wurden, bei bildmäßiger Anwendung eine schlechtere Konturenschärfe aufweisen als konventionelle Filme.
Der von mir definierte Kontrast (weiß/schwarz bzw. grau/schwarz) ist sozusagen eine primitive Version der Modulationsübertragung. Je kleiner der Abstand zwischen den unscharfen Linien wird, desto geringer wird meine Modulationsübertragung.
Bei Filmen werden zur Darstellung der Auflösung so genannte Modulationsübertragungskurven (MTF = Modulation Transfer Function) angegeben. Sie geben die Modulationsübertragung in Prozent (eine Art Kontrast) als Funktion der Ortsfrequenz in Zyklen je Millimeter (eine Art Linienabstand) an. Kodak gibt sie z. B. für T-max-Filme in [2] an.
Für Bild 2 habe ich Werte aus verschiedenen Datenblättern von Kodak (die leider nicht als Zahlen vorliegen, sondern nur als Kurven, daher sind die Werte nicht sehr genau) mit einander verglichen. Hier zeigt sich deutlich der Unterschied zwischen dem konventionellen T-max 100 und dem Mikrofilm Imagelink HQ.
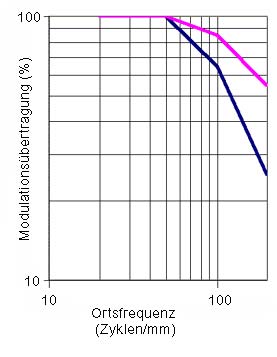
Bild 2: Grobe MTF-Kurven für Kodak T-max 100 und Kodak Imagelink HQ im Vergleich
(Pink: Imagelink. Blau: T-max)
Schärfe = ?
Zurück zur Startfrage: Für den Schärfeeindruck ist einerseits die Auflösung von Belang, andererseits der Detailkontrast und die Konturenschärfe. Von der Auflösung her sehen die Mikrofilme grundsätzlich besser aus als konventionelle Filme, aber nach dem oben Gesagten nicht von der Konturenschärfe her. Die Folge ist, dass ein konventioneller Film bei bestimmten Vergrößerungsmaßstäben wegen seiner Konturenschärfe (Die kann besser sein, weil der Film für bildmäßige Anwendung optimiert ist.) schärfer aussehende, wenn auch geringer aufgelöste Bilder erzeugen kann. Bei großen bis sehr großen Vergrößerungsmaßstäben fällt dann die bessere Auflösung des Mikrofilms wieder ins Gewicht.
Empfindlichkeit – wenn man sie denn so nennen mag
Bei Mikrofilmen spielt die Empfindlichkeit (wie bei anderen Dokumentenfilmen) keine große Rolle. Ist der Film unempfindlich, im Fotografenjargon „langsam“, so belichtet man eben länger oder holt sich stärkere Lampen. Den abzulichtenden Vorlagen ist das meist egal. Sie laufen nicht weg.
Anders bei der bildmäßigen Fotografie: Hat es mitunter Vorteile, wenn man bestimmte Motive per Langzeitbelichtung aufnimmt (Herumlaufende Menschen kommen dann nicht mit aufs Bild.), so sollte die Empfindlichkeit in den meisten Fällen aus praktischen Gründen doch nicht zu klein werden. Praktisch hat sich in der Mehrzahl aller Fälle als untere Grenze der Empfindlichkeit für bildmäßig zu verwendende Filme ein Wert von ISO 25/15° eingebürgert. Schon damit hat man oftmals Schwierigkeiten, bei Landschaftsaufnahmen Blätter noch scharf abzubilden.
Ein Teil der Kunst bei der Formulierung eines Entwicklers wie SPUR Imagespeed besteht denn auch darin, dem Mikrofilm eine möglichst hohe nutzbare Empfindlichkeit abzutrotzen, ohne Auflösung und Schärfe zu beeinträchtigen und dabei gleichzeitig den Kontrast innerhalb bildmäßiger Grenzen zu halten.
Korn
Über Filmkorn und Körnigkeit kursieren die wildesten Dinge. Was ist das ominöse Korn?
Das Bild besteht aus feinen Partikeln elementaren Silbers. Diese haben nicht etwa die Form von „Klumpen“, wie der Name Korn suggerieren könnte, sondern sind eigentlich feine Silberfädchen, auch Filamente genannt, die mit einander verknäuelt sind. Was wir im fertigen Bild als „Korn“ sehen, sind eigentlich kleine Löcher zwischen den Knäueln.
De gustibus non est disputandum. (Über Geschmack lässt sich nicht streiten.) Wenn sich zwei Menschen über dasselbe Korn unterhalten, kann es durchaus passieren, dass ein unbefangener Zuhörer gar nicht merkt, dass die beiden über dasselbe reden. So verschieden sind die Ansichten darüber, wie viel Korn man haben möchte oder zu ertragen bereit ist.
Korn kann dem Schärfeeindruck sehr zuträglich sein: Das Gehirn hat den Eindruck, ein Bild sei scharf, wenn das Bild viele feine und feinste Details enthält. Scharf abgebildetes Korn kann diese Rolle übernehmen und als Feinstruktur das Gehirn zu der Annahme verleiten, ein Bild sei scharf, auch wenn es eigentlich nicht scharf ist.
Das Korn eines gegebenen Films kann in recht weiten Grenzen durch die Belichtung und Entwicklung beeinflusst werden.
Es gibt allerdings ein objektives Maß für das Negativkorn, die so genannte RMS-Körnigkeit. Dabei wird in einer einheitlichen Fläche des Films mit einer bestimmten großflächigen Dichte (hier: 1,0) mit einem Mikrodensitometer gemessen. Ein Mikrodensitometer ist ein Densitometer, auf dessen Messkopf eine sehr enge Messblende sitzt (hier: 48 µm Durchmesser). Wenn man den Messkopf verschiebt, sieht man, dass auch eine einheitlich dichte Fläche auf kleinen Strecken deutliche Dichteschwankungen aufweist. Ein Mittelwert (Effektiv- oder RMS-Wert) dieser Schwankungen ist bei Angabe des Messblendendurchmessers ein praktikables Maß für die Körnigkeit, wenn man ihn mit unter identischen Bedingungen (insbesondere gleicher Blendendurchmesser und gleiche Dichte im Messbereich) gewonnenen Werten anderer Filme vergleicht. Beispielhaft seien ein paar RMS-Werte zitiert, die unter identischen Bedingungen gewonnen wurden:
|
Film |
RMS-Körnigkeit |
|
Kodak Technical Pan |
5 |
|
Kodak Imagelink HQ |
6 |
|
Fuji Neopan 100 ACROS |
7 |
|
Kodak T-max 100 |
8 |
|
Agfa Copex Rapid |
9 |
|
Kodak T-max 400 |
10 |
Man muss es Herrn Schain lassen, dass er seine Produkte nicht „schönlügt“: Ich persönlich empfand meine Großvergrößerungen mit Agfa Copex Rapid und Kodak Imagelink HQ beeindruckend kornarm (die des Copex schon körniger als die des Imagelink) und hatte das in meinem ersten Entwurf dieses Artikels auch so dokumentiert. Hier der O-Ton von Herrn Schain dazu:
„Bin allerdings der Meinung, daß der Unterschied zwischen Imagelink und Copex im Korn doch größer ist als von Ihnen dargelegt! Das Korn vom Imagelink entspricht etwa dem des Technical Pan, der als der bisher feinkörnigste Film gilt. Das Korn vom Copex ist doch deutlich gröber und manchmal (vor allen Dingen in den Himmelspartien, wenn der Himmel etwas Deckung hat) sogar schlechter als das vom Tmax 100.“
Haltbarkeit
Mikrofilme dienen der Archivierung und werden i.d.R. in maschinell verarbeitet. Sie müssen also mechanische Beanspruchungen durch die Entwicklungsmaschinen aushalten und nachher archivbeständig sein. Der Filmträger ist deswegen Polyester, und dieses Zeug ist reißfest und haltbar.
Aber: Fein verteilte Silberkörner sind anfälliger für aggressive Umweltchemikalien wie SO2 und NOx. Das liegt vermutlich daran, das so fein verteilte Körnchen bezogen auf die Bildsilbermenge eine riesige Oberfläche haben, die aggressiven Agenzien zugänglich ist. Das ist vermutlich der Grund, warum Mikrofilmarchive oft mit Haltbarkeitsproblemen der fertig verarbeiteten Filme zu kämpfen haben. Es bilden sich oft so genannte „Red Spots“. Man sollte daher aus meiner Sicht Mikrofilme wie Agfa Copex Rapid und Kodak Imagelink HQ, aber auch Dokumentenfilme wie MACO Ort 25c und andere feinkörnige Filme wie Kodak Technical Pan oder MACO TP 64c, MACO UP 25p, Efke KB 25 usw. am Schluss der Verarbeitung in einem Stabilisatorbad wie Agfa Sistan (s. Archivfeste Tonungen) oder Fuji AG Guard (m.W. in Europa nicht verfügbar) baden, um Problemen vorzubeugen. Agfa Sistan ersetzt dann auch das Netzmittel. Nach dem Sistan-Bad darf nicht mehr gewaschen werden. Agfa Sistan hat keinen wie auch immer gearteten Einfluss auf den Bildton oder die fotografischen Eigenschaften des Silberbildes und ist – das hat lt. Agfa das Image Permanence Institute (IPI) inzwischen nachgewiesen – ein wirksamer Schutz für das Bildsilber.
Des Pudels Kern: Die Anwendung
Erfreulicherweise muss man zur Anwendung der Filme und ihrer Verarbeitung nur wenig sagen. (Ärgerlich für den Kolumnisten: Er hat nicht viel zu schreiben.) Behandeln Sie Agfa Copex Rapid und Kodak Imagelink HQ wie andere Filme auch. Legen Sie sie nicht im prallen Sonnenschein in die Kamera ein und packen Sie während des Einspulens in die Entwicklungsspirale nicht auf die Schicht. Ansonsten gilt praktisch alles, was ich bereits unter Negativverarbeitung beschrieben habe.
Natürlich müssen Sie bei der Aufnahme wie auch bei der Vergrößerung sehr sorgfältig arbeiten, wenn Sie das Potenzial der Filme ausschöpfen wollen. Achten Sie also auf
- präzise Scharfstellung (s. auch Schärfentiefe und Auflösung),
- verwacklungsfreie Aufnahme (s. auch Verwackelung und Verreisen),
- korrekte Ausrichtung Ihres Vergrößerers (s. auch Ausrichtung Ihres Vergrößerers),
aber das sind alles Dinge, die zur „guten Handwerkspraxis“ gehören. Wenn Sie in Grenzbereiche vorstoßen, werden immer kleinere Effekte fühlbar, und nur wenn Sie alle Parameter optimieren, wird das Resultat wirklich optimal sein.
Die beiden Entwickler SPUR Nanospeed und SPUR Imagespeed kommen in 50-ml-Fläschchen daher und sind auch nach Teilentnahme (Sie brauchen 25 ml für einen Film.) recht haltbar. Trotzdem empfiehlt sich der nachgerade genial einfache Tipp von Herrn Schain, nach der Entnahme der ersten 25 ml des Konzentrats aus der Flasche diese mit Wasser aufzufüllen. Damit ist kaum noch Sauerstoff in der Flasche, der den Entwickler oxidieren kann, und man kann beim nächsten Ansatz ganz einfach den gesamten Flascheninhalt in eine Mensur kippen und auf 250 ml auffüllen, um seinen Entwickler fertig zu haben.
Die Fixage ...
... verdient es aber doch noch, kurz extra erwähnt zu werden: Die beiden Filme haben Emulsionen mit extrem geringen Silbergehalt. Dadurch fixieren Sie in modernen Hochleistungsfixierbädern blitzartig aus. Klärzeiten von 15s (Dies entspricht einer Fixierzeit von 30 bis 45s.) sind normal. Wenn Sie dann (Stichwort: „Mach‘ ich immer so!“) stur nach Beipackzettel des Fixierbades 3 Minuten fixieren, kann es schon dazu kommen, dass von den chemisch angreifbaren (s.o.) feinen Körnchen ein paar weggefressen werden. Bestimmen Sie also bei Mikrofilmen auf jeden Fall die Klärzeit und fixieren Sie für etwa die doppelte bis dreifache Zeit, aber nicht länger.
Mikrofilme und Filmscanner
Die immer beliebter werdenden Filmscanner für Privatanwender sind für Farbfilme optimiert. Bei Farbfilmen besteht aber das Bild aus diffusen Farbstoffwölkchen. Bei Silberhalogenid-Negativen besteht es dagegen aus „Körnern“ mit wesentlich schärferen Grenzen. Damit haben Filmscanner so ihre Probleme, die dazu führen, dass das Filmkorn in Ausdrucken von Scans störender hervortritt als bei gleich großen nasschemisch erzeugten Vergrößerungen. Dieses Problem ist bei so feinkörnigen Filmen keines mehr.
Ein zusätzlicher Bonus ist die glasklare, nicht eingefärbte Unterlage der beiden Mikrofilme. Mikrofilmnegative lassen sich daher ganz hervorragend scannen und weiterverarbeiten.
Es bleibt allerdings – leider – dabei, dass Staub- und Kratzerkorrekturfunktionen auf Basis von IR-Scans, wie z. B. ICE3 bei Nikons Coolscan-Modellen und gleichwertige Funktionen, die von Canon, Epson und anderen Herstellern angeboten werden, nicht funktionieren. Das liegt daran, dass diese Funktionen nur funktionieren können, wenn das Bild selber, anders als der Staub, im Infraroten transparent ist, und das sind organische Farbstoffe, aber Silber ist es nicht.
Nach so vielen Ähnlichkeiten: die Unterschiede
Nicht nur mich selbst, sondern auch Herrn Schain habe ich schon bei der ersten Ankündigung seines neuen Verfahrens gefragt, worin eigentlich die Unterschiede zwischen Agfa Copex Rapid und Kodak Imagelink HQ bestehen. Zunächst sah es für mich fast so aus, als wolle Herr Schain sich selbst Konkurrenz machen. Aber es gibt Unterschiede:
Agfa Copex Rapid entwickelt in SPUR Nanospeed
... ist von den beiden Filmen eindeutig der gutmütigere. Sie können ihn guten Gewissens „im Zweifel etwas reichlicher“ belichten, ohne deswegen gleich kugelsichere Lichter und schwer vergrößerbare Negative zu erzeugen. Er ist auch rund 1/2 bis 2/3 Blende empfindlicher als Kodak Imagelink HQ. Die Empfindlichkeit des Agfa Copex Rapid beträgt rund ISO 40/17°. Die Auflösung ist dafür etwas geringer als beim Kodak Imagelink HQ, das Korn ist deutlich ausgeprägter (s.o.).
Kodak Imagelink HQ entwickelt in SPUR Imagespeed
... vermittelt einen erheblich besseren Schärfeeindruck. Ich führe das auf den gegenüber dem Agfa Copex Rapid größeren Detailkontrast zurück. Die Auflösung ist, wie oben schon erwähnt, geringfügig höher als beim Agfa Copex Rapid. Geschlossene Flächen einheitlicher Helligkeit kommen bei beiden Filmen bei den gängigen Vergrößerungsmaßstäben (25fach ist wohl nicht mehr „gängig“.) ziemlich kornarm, beim Kodak Imagelink HQ mit einer Nasenlänge Vorsprung.
Den Agfa Copex Rapid habe ich als „gutmütig“ bezeichnet. Der Kodak Imagelink HQ verhält sich hinsichtlich Belichtungsspielraum eigentlich so, wie man es von „normalen“ Filmen her gewohnt ist. Er reagiert also auf Überbelichtung und Überentwicklung wie die meisten anderen SW-Negativfilme auch: Er liefert harte, vielleicht manchmal etwas schwerer vergrößerbare Negative. Um das beim Agfa Copex Rapid zu erreichen, muss man sich schon anstrengen.
Die Sensibilisierungskurve des Kodak Imagelink HQ erstreckt sich nicht so weit in den roten Bereich wie die eines üblichen panchromatischen Films. Im Prinzip handelt es sich daher bei diesem Film auch um einen orthopanchromatischen Film. Die Effekte der geringeren Rotempfindlichkeit habe ich detailliert in meinem Beitrag zu Fuji Neopan 100 Acros und MACO PO 100c (Orthopanchromatische Filme) beschrieben. Eine der von mir genannten Anwendungen waren simulierte „Antik“-Fotos. Die frühen Materialien hatten eine im Trend eher „blaulastige“ Sensibilisierung, die Ihnen eine bestimmte Wirkung verleiht. Gleiches gilt eingeschränkt auch für den Kodak Imagelink HQ. In Photo.net (http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=004yLt und http://www.photo.net/photodb/folder?folder_id=299866) zeigt Herr Schweigl sehr gelungene Ergebnisse derartiger Experimente. Hier wird die Wirkung noch dadurch unterstützt, dass ein sehr lichtstarkes Objektiv (Noctilux) bei voller Öffnung verwendet wurde. Der resultierende Schärfeabfall von der Bildmitte nach außen (der selbst bei einem solch tollen Objektiv auftritt) sowie die geringe Schärfentiefe unterstützen die Bildwirkung noch.
Wann lohnt sich ein hochauflösender Film?
Aus der Fragestellung geht schon hervor, dass Mikrofilme nicht immer automatisch die „besseren“ Bilder ergeben.
Wenn Sie ein Motiv groß ins Bild setzen und das endgültige Bild nicht sehr stark vergrößern, wird von der theoretisch vorhandenen Auflösung des Materials möglicherweise nicht viel genutzt. Erstens sind bei dem schon im Negativ groß abgebildeten Motiv auch die feinen Details noch recht groß, und zweitens werden Dinge, die der Film noch aufgelöst hat, so klein wiedergegeben, dass das Auge sie im Bild nicht auflösen kann. Hier lohnt der Mikrofilm nicht, im Gegenteil: Aufgrund seiner schlechteren Konturenschärfe kann der Bildeindruck insgesamt weniger scharf ausfallen. Ein Beispiel könnte eine formatfüllende Porträtaufnahme sein, die nur mäßig vergrößert wird. (Vielleicht 18 ´ 24 cm, eine genaue Grenze lässt sich nicht angeben.)
Wenn Sie auf der anderen Seite eine gotische Kathedrale mit dem 28er Weitwinkel in Gänze abbilden und davon ein Poster im Format 40 ´ 60 cm erzeugen, hat der Mikrofilm eindeutig die Nase vorn. Hier würde der konventionelle Film Details nicht mehr auflösen, die der Mikrofilm (Gute Aufnahmetechnik immer vorausgesetzt!) noch darstellt.
Auf den Punkt gebracht:
|
Motiv im Negativ groß,
Motiv im Negativ klein und feinstrukturiert, |
Wenn Sie hochauflösenden Film verwenden möchten/müssen ...
Welcher hochauflösende Film ist der richtige für Sie?
Der Agfa Copex Rapid ist der Film der Wahl für die Miniaturkamera- und Minox-Gemeinde, bei deren winzigen Negativen es wegen der nötigen großen Vergrößerungsmaßstäbe auf jede mögliche Qualitätsreserve ankommt. Auf der anderen Seite gestatten die Miniaturkameras oft keine so präzise Belichtungsmessung, so dass man auf etwas Spielraum angewiesen ist.
Auch in anderen Situationen, wo es auf Belichtungsspielraum ankommt, also extrem kontrastreiches Licht, würde ich persönlich dem Agfa Copex Rapid den Vorzug geben. Auch wer ob der neuen Technik Berührungsängste hat, möge zunächst den Agfa Copex Rapid ausprobieren. Die Verarbeitung ist aus meiner Sicht ziemlich tolerant, fast narrensicher.
Der Kodak Imagelink HQ auf der anderen Seite ist der Film der Wahl für all die Fälle, wo die Lichtsituation normalen oder gar niedrigen Kontast aufweist (Entwicklungen bis N+3 sollen möglich sein, hab’s aber noch nicht probiert.) und es auf kornarme bis kornlose, hoch aufgelöste Bilder ankommt.
Fazit
Großformatqualität vom KB-Negativ werden Sie auch mit Mikrofilmen nicht erzeugen, denn bei Großformataufnahmen können Sie bei gleicher Detailgröße im fertigen Bild einen Bereich von Ortsfrequenzen im Negativ nutzen, wo auch konventionelle Filme noch prima mit der Auflösung mithalten können, aber von der Konturenschärfe her besser aussehen als der vom KB viel stärker vergrößerte Mikrofilm. Aber die beschriebenen Filme werden Sie bei richtiger Handhabung in Lage versetzen, vom KB-Negativ Bilder mit bis dato unerreichbarer Qualität zu erzeugen, wie Sie mancher Großformat-Fotograf vielleicht aufgrund seiner nicht ganz so stringenten Arbeitsweise nicht zu erzeugen vermag.
Literaturhinweise
[1] Ctein, Post Exposure - Advanced Techniques for the Photographic Printer, Focal Press 1997, ISBN 0-240-80229-3 (Dieses Buch ist vor einiger Zeit in etwas veränderter Form neu erschienen.)
[2] KODAK PROFESSIONAL T-MAX Films: Tech Pub F-4016 http://imaging.kodakalaris.com/sites/prod/files/files/products/f4016_TMax_100.pdf
[3] H. Schain, Die spezielle Problematik der Verwendung von Mikrofilmen in der bildmäßigen Fotografie (Fachaufsatz, erhalten von H. Schain, 23. Juni 2003).
[4] Datenblatt Fuji Neopan 100 ACROS: http://www.blende7.at/datenblaetter/fuji/Acros.pdf
Lückenbüßer
(ein Artikel, der nicht geplant war)
Thomas Wollstein
Juli 2003
Vorrede
Eigentlich sollte diesen Monat ein ganz anderer Artikel hier stehen, einer, in dem es mal wieder so richtig ins Technische ging. Aber, wie der Teufel es will, hat sich kurz vor Redaktionsschluss noch eine Unklarheit ergeben, die weiterer Recherchen bedarf, und ich musste innerhalb eines Tages etwas Neues auf die Beine stellen. Es geht in dieser Kolumne um Fotografie, was lag also näher, als Ihnen ein paar meiner Fotos zu zeigen? Zur Technik sage ich diesmal nicht viel, sondern nur zu einem Reiseziel, das ich gerne besuche. Die Idee zu diesem Artikel verdanke ich nicht zuletzt Walter Vogels Buch über Italien. Es ist ein wunderschönes Buch über – wie Herr Vogel es nennt – ein Bilderland. Wenn Sie ein Buch mit tollen SW-Bildern von einem Fotografen lesen wollen, der mittlerweile rund 5 Jahrzehnte im Geschäft ist, ist das ein Buch für Sie. Meine Bilder können sich damit nicht messen. Aber es sind meine, und sie geben meine Sehweise wieder. Mehr zählt nicht.
Also denn, es geht um:
Venedig
|
|
Walter Vogel hatte mich gewarnt: „In Venedig ist es schwierig, nicht zu viele Bilder zu machen.“ Ich wusste, dass er Recht hat, denn ich fahre immer wieder nach Venedig, und immer sehe ich es neu. Venedig bietet so viel Schönes, und selbst das nicht so Schöne reizt zum fotografieren. Canal Grande von Rialto Richtung Salute |
Widmen wir uns aber erst einmal den Klischees:
Canal Grande
|
|
Venedig hat, wenn ich mich recht erinnere, so an die 400 Brücken und Brückchen, aber den Canal Grande können Sie nur an drei Stellen auf Brücken überqueren: vor dem Bahnhof über die Barfüßerbrücke, den Ponte dei Scalzi, über Rialto, und über die große Holzbrücke bei Accademia. Zwischen den Brücken gibt es aber etwas viel Interessanteres, nämlich die Traghetti. Ein Traghetto ist eine zum Massentransportmittel umfunktionierte Gondel. Als ich zum ersten Mal davon hörte, wollte ich das ausprobieren, und als meine Frau sah, dass in einer schmalen Gondel rund 15 Leute standen, wollte Sie mit meiner Tochter (damals 4 Jahre alt) lieber nicht ein so ein Ding steigen. Mir kam das sehr gelegen. Ich ließ fast mein ganzes Gepäck bei den beiden (Wer fällt schon gerne mit seiner ganzen schweren Ausrüstung in den Bach?) und fuhr einmal hin und einmal zurück. Das kann man sich locker leisten, kostet doch eine Passage mit dem Traghetto nur 40 ct. Entsprechend wenig beliebt ist dieser Dienst bei den Gondolieri, die ihn turnusmäßig (wie bei uns den Apotheken-Notdienst) absolvieren müssen. Inzwischen, nachdem sie gesehen hat, dass die Venezianer das schon können (und Touris benutzen die Dinger wenig), und dass ein Traghetto auch mit 15 Leuten drin nicht untergeht oder kentert, fährt meine Frau übrigens lieber Traghetto, als dass sie über eine der drei großen Brücken geht. Wenn man die Wahl hat, sich über Rialto schieben zu lassen oder bei Santa Sofia das Traghetto zu nehmen und in aller Ruhe über den Canal geschippert zu werden,… Gondoliere beim Traghetto-Dienst |
Markusplatz
|
|
Dass sich hier nicht nur die Tauben knubbeln, sondern auch die Touristen, tut der Schönheit der Piazza (In Venedig heißt nämlich nur ein Platz „Piazza“, und das ist dieser.) kaum Abbruch. Hier pulst das Leben. Zu diesem Klischee gehört auch einfach die Band, die so furchtbar falsch und übermäßig pathetisch gleich hintereinander Frankieboys „My Way“ und einen Strauß-Walzer spielt. Der Kellner des Gran Café Florian ist sich denn auch seiner herausgehobenen Stellung sehr bewusst und kann sich als einer der wenigen in Venedig eine Ausstrahlung leisten, bei der die Verachtung für die Touristen aus jedem Knopfloch strömt. Die Band vor dem Gran Café Florian und ein Kellner des Florian |
|
|
Als ich vor zwei Jahren im Januar in Venedig war, ging ich abends um 21 Uhr spazieren – und Venedig war wie eine Geisterstadt. Die drei Leute, die man am Markusplatz noch traf, konnte man glatt vernachlässigen. Und wenn irgendwo, ein paar Kanäle weiter, eine Frau mit hochhackigen Pumps unterwegs war, konnte man das hören, auch wenn man die Urheberin des Geräuschs nicht sehen konnte. Die Kulisse für Gruselkrimis! Dieses Jahr war ich um Ostern da. Wieder wollte ich den Markusplatz für mich haben, aber diesmal war dort auch um 22 Uhr noch die Hölle los. Zwei Bands spielten im Wechsel, und die Cafés hatten immer noch reichlich Kundschaft. Daher mein Rat weiter oben: Wenn Sie ungestört fotografieren wollen, stehen Sie früh auf, oder kommen Sie im Winter. Gran Café Quadri |
Caffé
|
|
Caffé, noch ein Grund Italien zu lieben. Nicht die dünne, an Säure reiche Plörre, die man hierzulande trinkt, sondern eine Flüssigkeit mit einer spürbaren Viskosität, bei uns Espresso genannt, aber in Italien nur Caffé. In Venedig, wie eigentlich überall in Italien noch preiswert zu haben, wenn man ihn im Stehen an der Bar trinkt (typischerweise für 80 ct.), oder teuer, wenn man sich an den Tisch setzt (meist das Doppelte). Mit reichlich Milch, als Caffélatte oder Capuccino, ist er der substanziellere Teil eines italienischen Frühstücks. Der Rest ist ein Brioche, eine Art ziemlich klebriger, mit Marmelade oder Pudding gefüllter Croissant. Morgens früh um halb acht, wenn die Cafés gerade öffnen, auf dem Campo Santa Margherita so zu frühstücken sollte man sich nicht entgehen lassen. Capuccino |
Gondeln
|
|
Nicht alles, was in Venedig mittels Rudern bewegt wird, sind im Übrigen Gondeln. Eine Gondel hat am Bug den Ferro, das Eisen, dieses S-förmige Stahlteil, welches den sich durch Venedig windenden Canal Grande, die sechs Stadtteile (Sestieri) und die Giudecca darstellt. Viel schöner finde ich die schlichten Sandoli, die meist kleiner, am Bug nur eine recht schlichte Verzierung aufweisen. Blick über den Bug eines Sandolo |
Aber es gibt mehr als den Canal Grande
|
|
Die von Motorbooten erzeugten Wellen schaden Venedig. Venedig steht auf Tausenden von in den Lagunenschlamm gerammten Eichenstämmen. Ein solcher Eichenstamm wird, wenn er denn unter Luftabschluss verbleibt, steinhart und trägt verlässlich das Fundament für ein Haus. Wird er jedoch durch Wellen immer wieder der Luft ausgesetzt, so wird er Stück um Stück zerfressen. Daher dürfen in vielen Seitenkanälen die Motorboote, wenn überhaupt, nur sehr langsam fahren. Überhaupt ist ganz Venedig derzeit eine große Baustelle. Überall zerfällt etwas und muss geflickt werden. Doch sollte Venedig eines Tages „wie neu“ aussehen, wäre es wohl nicht mehr Venedig, sondern eine Art Disneyland. Das echte Venedig finden Sie heute in den abseits gelegenen Bereichen, stückweise im schicken Sestiere di Dorsoduro, im schon etwas bürgerlicheren San Polo, und v.a. im relativ armen Cannaregio. So an die 60 000 Venezianer soll es noch geben. Sie können sich nicht von ihrer Stadt trennen, die zwar einige praktische Nachteile hat (Machen Sie mal einen Umzug per Boot, oder kaufen Sie jeden Tag zu Fuß ein.), die aber auch dank völliger Abwesenheit der Blechpest – gemeint ist das Auto – eine sehr leise Stadt ist. Durchblick in Venedig |
Campo und Campiello: Kommunikationszentren
|
|
Wie schon erwähnt, heißen Plätze in Venedig nicht, wie sonst meistens in italienischen Städten, Piazze, sondern Campi oder Campielli. Der Name Piazza ist dem Markusplatz vorbehalten. (Streng genommen auch nur einem Teil davon, der andere heißt Piazzetta.) Auf den Plätzen trifft man sich, man sitzt oder steht, man diskutiert. Heute, da man in Venedig „nichts mehr werden kann“, sind es hauptsächlich ältere Menschen, die dort sitzen. Campo = Kommunikationszentrum |
Literatur (nicht speziell zu Venedig)
Walter Vogel, Italien – Reisen in ein Bilderland, Edition Christian Brandstätter, 1999, ISBN 3-85498-003-5
Alle Bilder © Thomas Wollstein
Für die Ewigkeit gemacht
Über die Haltbarkeit (physisch und inhaltlich) von Fotos
Thomas Wollstein
Juni 2003
Print Permanence, die Haltbarkeit von Abzügen, beschäftigt immer mal wieder die Fotografen. Auch ich habe ihr schon die eine oder andere Kolumne gewidmet (Fotos auf PE-Papier, Archivfeste Tonungen). Dabei habe ich mich immer nur mit dem Aspekt der physischen Haltbarkeit des belichteten Materials befasst. Was aber ist mit den Inhalten?
|
|
Jeden Morgen auf dem Weg zum Büro überquere ich auf einer Brücke eine Bahnstrecke, und in letzter Zeit fiel mir auf, dass die Gleise rostig werden und dazwischen mehr und mehr Grünzeug wächst. Offenbar wird der Abschnitt nicht mehr genutzt. Nicht, dass der Anblick der Bahnschneise ein ästhetischer Hochgenuss ist, doch – wie ein Bekannter, der Fotograf Walter Vogel aus Düsseldorf, neulich treffend sagte – "Da muss man nur seine Kamera irgendwie hineinhalten, und schon hat man ein verrücktes Strukturfoto." Tatsächlich habe ich genau solche Fotos vor einiger Zeit gemacht, u.a. weil mir das Grünzeug jetzt im Frühjahr u.a. optimal für interessante IR-Fotos erschien, teils aber auch als Dokumentation. Das strenge Muster der Schienen, dem sich das wild wuchernde Kraut widersetzt, seit es für die DB nicht mehr lohnt, es mit Herbiziden niederzuhalten, hat seinen Reiz. In letzter Zeit werden dort Gleise "zurückgebaut", was der neudeutsche Ausdruck für "abmontiert" ist. Damit gewinnen meine Fotos neben dem ästhetischen Wert (den sicher jeder anders beurteilt) auch noch einen dokumentarischen, wenn demnächst dieselbe Fläche von wieder einem neuen Bürohochhaus belegt wird. Das hat mich dazu veranlasst, mich zu fragen, warum ich eigentlich Wert darauf lege, meine Fotos besonders langlebig zu machen und bei welchen Fotos sich das überhaupt lohnt. Schienen |
Wie lange hält ein Bild?
Papierbilder
Ein sauber verarbeitetes SW-Bild, gleich ob PE-Papier oder Baryt, hält unter nicht zu miserablen Lagerungsbedingungen locker seine 50 Jahre. Baryt mit zusätzlicher Stabilisierung durch Schwefel-, Selentoner, Goldtoner und/oder Agfa Sistan (dessen Wirksamkeit inzwischen durch das Image Permanence Institute nachgewiesen wurde) und sorgfältig gelagert, kann Hunderte von Jahren halten.
Bei den organischen Farbstoffen von nasschemisch erzeugten Farbbildern sieht es nicht ganz so toll aus, aber auch verblichene Kodachromes aus der Anfangszeit der Farbenfotografie (wie sie damals noch genannt wurde) sind noch erkennbar und erstrahlen mit Hilfe von Rechentechnik (Digital ROC®), wie in Filmscanner eingebaut ist oder als Photoshop-Plug-In käuflich erworben werden kann, sogar wieder in altem Glanz.
Auch bei Fotodrucken aus dem Computer hat sich einiges getan. Waren die ersten Farbdrucke schon nach 6 Monaten nicht mehr ansehnlich, sind Ausdrucke mit vielen der heute erhältlichen hochwertigen Tinten mindestens so stabil wie nasschemisch erzeugte Farbbilder, und wenn man kleine Abstriche in der Größe des darstellbaren Farbraums hinnimmt, sogar erheblich länger als viele SW-Bilder (z. B. Pigmenttinten des EPSON Stylus Photo 2000p: geschätzte Lichtechtheit ca. 200 Jahre).
Negative
Im Bereich KB- und MF-Rollfilm ist Zellulosetriazetat als Träger wohl am weitesten verbreitet. Dieses Material kann bei kühler und – noch wichtiger – trockener Lagerung recht lange halten, unter guten Bedingungen 100 Jahre und mehr. Unter schlechten Bedingungen (hohe Luftfeuchte, hohe Temperatur, Licht) kann es aber auch schon in wenigen Jahren anfangen zu schrumpfen (so sehr, dass sich die Schicht ablöst) und zu zerfallen. (Schnuppern Sie mal an Ihrem Negativordner. Riecht es nach Essig? Das wäre ein Alarmsignal.)
In letzter Zeit unternehmen insbesondere Kodak und MACO offenbar Schritte dahin, MF-Rollfilm und, soweit möglich, auch KB-Film auf Polyesterträger zu gießen. Bei Planfilmen ist Polyester schon länger etwas üblicher. Polyester (PE) ist mechanisch und chemisch erheblich stabiler als Zellulosetriazetat. Man erwartet, dass PE-Träger 500 Jahre unverändert halten. Aus diesem Grund wird es auch als Träger für Mikrofilme genutzt, deren primärer Zweck eben die Langzeit-Archivierung ist.
Glasplattennegative sind chemisch mindestens so beständig, aber "Glück und Glas, wie leicht bricht das!" Zudem sind sie schwer und benötigen viel Platz.
Daten
Ein düsteres Kapitel! Mag eine CD-ROM rein vom Material her noch mit großer Wahrscheinlichkeit ein paar Jahrzehnte lesbar bleiben, wenn sie nicht durch Einwirkung von roher Kraft, Wärme oder Licht misshandelt wird, so ist nicht klar, welche Software etwa in 20 Jahren noch die Dateiformate von heute wird verstehen können. Jedem, der größere Bildbestände auf CD sichern möchte, kann man nur raten, seine CDs in regelmäßigen Abständen, spätestens bei jedem Hard- und Software-Update auf die nächste (bessere?) Version mit der neuen Software zu öffnen und in dem einfachsten zur Verfügung stehenden Datenformat verlustfrei (also z. B. TIFF unkomprimiert statt JPEG mit hoher Kompression!) wieder abzuspeichern. Bei einem Versionssprung von 1 sind die Dateiformate zwar vielleicht noch mit der neuen Version lesbar, aber die Erfahrung lehrt, dass schon ab einem Sprung von 2 niemand mehr irgendeine Kompatibilität garantiert. Eine ganz schlechte Wette sind proprietäre Formate, die nur von der Software eines einzigen Herstellers verstanden werden.
Nutzen Sie beim Abspeichern der Daten auf CD (oder was auch immer) möglichst auch das einfachste verfügbare Datenträgerformat und Ablagesystem, also nicht etwa irgendein Backupformat, das eine Auspacksoftware braucht. Wer weiß, ob die auf der nächsten oder übernächsten Version Ihres Betriebssystems noch läuft, selbst wenn Sie beim selben Rechnersystem bleiben!
Hier unterscheiden sich übrigens PCs und die in der Grafiker-Welt zum Quasi-Standard gewordenen MACs: Letzterer hat vom Betriebssystem schon die Möglichkeit eingebaut, PC-CDs zu lesen. Umgekehrt soll es mit zusätzlichen Tools gehen.
Aber Sie ahnen schon, was passieren wird: Wenn Sie im Jahr nur 10 KB-Filme verschießen – aus meiner Sicht eine sehr moderate Zahl – und die Negative digital archivieren wollen, haben Sie am Ende des ersten Jahres 360 Dateien. Beim nächsten Update in vielleicht zwei Jahren, schon über 1000, die Sie möglicherweise alle einmal – vermutlich in Handarbeit – öffnen und wieder neu abspeichern müssen. Im Laufe der Jahre kommen Sie nur noch zum Umspeichern, aber nicht mehr zum Fotografieren. (Oder Sie vertrauen auf Gott und aktualisieren die Daten nicht.)
Einen optischen Vergrößerer für ein Negativ könnte man selbst in 500 Jahren noch mit Hausmitteln zusammenschustern, und wenn es dann noch EDV, pardon: IT, gibt, kann man die Negative auch noch scannen. Doch wer wird in 500 Jahren noch wissen, was sich die Programmierer bei der Vereinbarung des TIFF-, PSD-, JPEG-, PCX- oder Weißnichwas-Formats gedacht haben?
Aber wer guckt sich die Bilder dann noch an?
Meine Tochter wird sich vielleicht in 50 Jahren noch meine Bilder angucken, weil die Bilder ein Stück meiner Seele abbilden und es ihr so erlauben, ihrem Vater gedanklich näher zu sein, der dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon nicht mehr leben wird. Für sie sind möglicherweise alle meine Bilder einfach deswegen interessant, weil sie von mir sind. Dabei spielt der Inhalt keine so immens große Rolle.
Aber wird es unter meinen Bildern in 50 Jahren auch welche geben, die Herrn Müller von gegenüber, der mich nicht kannte und daher keinen direkten emotionalen Bezug zu den Bildern hat, interessieren?
Ansel Adams hat viele Landschaftsfotos von fantastischer Schönheit und handwerklicher Qualität geschaffen, und ähnliches gilt für Edward Weston mit seinen Ausflügen in die Welt des Gemüses, der Schalentiere und der Haushaltskeramik und wer weiß wie viele andere der "Alten Meister". Ich schaue mir immer mal wieder solche Bilder zusammen mit Bekannten und Freunden an, und immer wieder merke ich, dass viele sich zwar der Schönheit dieser Bilder nicht verschließen können, dass aber ob des Inhalts doch mehr oder weniger Gleichgültigkeit vorherrscht.
Wenn ich in unser Stadtmuseum gehe und mir die Portraits (Gemälde) unserer Fürsten ansehe, kann ich auch nicht umhin, die technischen Fertigkeiten der Maler zu bewundern, aber nach dem dutzendsten Fürsten ähneln sich die Posen und Nasen dann doch, und viel interessanter ist es, zu sehen, wie sich das Äußere der Fürsten, die "Mode" im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Noch viel interessanter finde ich mitunter Bilder wie die des Bauern-Breugel, der "einfache Leute" abgebildet hat, und die, obschon idealisiert, in vielen kleinen Details dann doch realistisch und detailgetreu zeigen, welches Geschirr und Werkzeug man vor ein paar Hundert Jahren verwendet hat. Manche Bilder erlauben eine Zeitreise.
|
|
Oder ein Bild, aufgenommen aus dem Fenster der Wohnung, in der die Familie meiner Frau lebte, als meine Frau 2 Jahre alt war, also noch jünger als meine Tochter jetzt: Eine ziemlich leere Straßenkreuzung, an der ein paar Autos parken. Ganz wenige Fernsehantennen. Eine Frau geht mit Ihrem kleinen Kind an der Hand über die Straße. (Sie werden's erraten: Das Kind ist meine Frau.) Technische Qualität: Na ja. Aussage: Keine? Warum hat der Fotograf das Bild dann damals aufgenommen? An derselben Ecke können Sie heute vielleicht sonntags morgens um drei riskieren, mitten auf der Straße zu gehen, aber einen Parkplatz finden Sie da auch dann nicht. Die Häuse sind mit Satellitenschüsseln gespickt. Oder Bilder aus dem Haushalt der Familie meiner Frau vor vielen Jahren. Solche Bilder sind fast eine Form von moderner Archäologie. Langer Straße |
|
|
Man mag einwenden, dass mich diese Bilder faszinieren, weil es eben ein Stück meiner Familiengeschichte ist, das sie darstellen. Da ist sicher etwas dran. Dennoch scheinen mir Bilder, die auch ein Stück den Alltag dokumentieren, wie Sie z.B. Berenice Abbot oder Walker Evans gemacht haben, nicht nur für mich von bleibenderem Interesse zu sein als manches technisch perfekte, aber eben teilweise auch steril wirkende Meisterwerk.
|
Also nur noch "knipsen" und das Alltagsleben dokumentieren?
Das könnte ich wohl selber nicht. Es gibt Orte und Momente, da packt es mich, und ich muss fotografieren. Sorgfältig, mit Stativ und Gedöns. Für mich. Um ein Bild zu machen. Egal, wem es gefällt, gleich ob jetzt oder morgen oder sonst irgendwann. Meine Frau und meine Tochter fangen an, diese Situationen zu erkennen und sprechen mich dann gar nicht mehr an, weil ich außer "Jajaja!" sowieso nichts sage und auch gar nicht richtig zuhöre. (Sie kennen das sicher: Nicht nur bei Fotografen heißt "Ja." einfach "Ja.", "Jaja!" heißt "Nein" oder "Jetzt nicht!", und "Jajaja!" heißt, höflich umschrieben, "Bitte nicht stören!".) Das sind dann die Bilder, die ich brauche, an denen mir am meisten liegt.
Es sind aber wahrscheinlich oft nicht die Bilder, die andere anrühren.

Fahrradleiche

Kreuze
Ich denke, es kann Bilder von bleibendem inhaltlichen Wert geben, aber es werden – das ist meine Überzeugung – oft nicht die "künstlerisch wertvollen Fine-Art-Prints" sein (Die empfinde ich bei mir, aber auch bei anderen, oft als "Selbstbefriedigung"), sondern möglicherweise Allerweltsbilder mit mehr oder weniger journalistischem oder dokumentarischem Inhalt, Bilder, die teilweise auch nicht von optimaler technischer Qualität sein werden, die aber die Umgebung und die Zeitgenossen des Fotografen bei alltäglichen Dingen abbilden, die den Menschen in 50 Jahren zeigen, wie man "damals" gelebt hat.
Daher möchte ich Sie stimulieren, auch einmal die Groß- oder Mittelformatkamera zur Seite zu legen, die KB-Kamera in die Tasche zu stecken und sich damit auf die Welt außerhalb des Fine-Art-Elfenbeinturms einzulassen. Fotografieren Sie sich, Ihre Freunde, Ihre Familie, Unbekannte, Alltägliches, haben Sie Spaß daran und kümmern Sie sich nicht darum, ob "künstlerisch wertvolle" und technisch hochwertige Bilder dabei entstehen. Wenn Sie ein fortgeschrittener Fotograf sind, wird auch manches nur so "hingeschmissene" Bild einfach aufgrund Ihrer Routine (oder Dank guter Automatikfunktionen der Kamera) schon von akzeptabler technischer und meist auch ästhetischer Qualität sein. Archivieren Sie die Bilder, und schauen Sie sie in ein paar Jahrzehnten wieder an. Vielleicht ist manches dabei, worauf Sie nicht so stolz sind wie auf den Platindruck von der unberührten Landschaft im Sankt-Ansel-Nationalpark, was Sie und Ihre Mitmenschen aber im Herzen berühren wird.
Und wenn Sie den Film dann als völlig verschwendet betrachten, kann es Ihnen doch passieren, dass diese "Ausschweifung" Ihr Gehirn irgendwie angeregt hat, denn das Gehirn macht es sich zwar gerne einfach (wie der Bierbauch, der auch immer wieder gute Gründe ans Gehirn liefert, warum gerade jetzt die Jogging-Schuhe Ruhe brauchen), aber nichts ist so schädlich für seine Flexibilität und Kreativität.
Ich empfehle Ihnen als Lektüre das Buch "Helden des Alltags" von Wladimir Kaminer und Helmut Höge, erschienen bei Goldmann, das ich vor kurzem zum Geburtstag geschenkt bekam. Es war Kaminers lakonische Sichtweise der Menschen zusammen mit den von Helmut Höge gesammelten Bildern wildfremder Menschen aus Haushaltsauflösungen, die die Umsetzung von Beobachtungen, die ich im Laufe der Jahre an anderen und an mir gemacht habe, in diesen Artikel katalysiert haben.
Bitte ein Bit (und noch eins und noch eins und noch eins ...)
Warum es besser ist, Bilder mit mehr Bits zu scannen
Thomas Wollstein
Mai 2003
Meine Scanner-Treiber bieten mir an, die Daten meiner farbigen Vorlagen oder Negative mit 24, 36, 42 oder gar 48 bit je Kanal an Bildbearbeitungssoftware weiterzureichen, aber mein Drucker kann nur mit 24-bit-Farbdaten etwas anfangen. Und mein Drucker ist da nicht allein: M.W. gibt es kein einziges Ausgabegerät, dass Daten mit mehr als 8 bit je Kanal (24 bit bei RGB-Farbdateien) unterstützt. Auch viele Bildbearbeitungsprogramme unterstützen nur Daten mit 8 bit je Kanal, und die, die bis zu 16 bit vertragen (z. B. Photoshop), stellen in diesem Modus nicht alle Funktionen zur Verfügung. So funktionieren zwar die globalen Tonwertanpassungen und bestimmte Pinselfunktionen, aber z. B. nicht ein einziges Filter. Stellt sich also die Frage:
Wozu sind die vielen Bits gut?
Grundlegendes
Aufgabe des Scanners ist es, die kontinuierlichen Tonwerte einer Vorlage in diskrete digitale Daten umzuwandeln. "Kontinuierlich" bedeutet folgendes: Wenn ich einen Tonwert X habe, dann kann in der Vorlage auch ein beliebig geringfügig von diesem verschiedener Tonwert X+Δ vorkommen. Digitale Werte aber sind diskret. Das bedeutet, wenn Tonwert X digital z. B. als Zahl 5 dargestellt wird, dann muss sich die Software überlegen, ob sie den ganz leicht von X verschiedenen Wert X+Δ auch als 5 oder schon als 6 darstellen soll. Wird aber der Wert X+Δ nicht als vom Wert X verschieden erkannt, geht Information verloren, das Bild wird "schlechter".
Wie groß der Wert Δ ist, um den sich zwei Tonwerte der Vorlage unterscheiden müssen, damit sie in der Datei als verschieden gespeichert werden, hängt bei einer gegebenen Vorlage davon ab, wie viele Werte zur Verfügung stehen, um den Vorlagenumfang in Zahlen umzusetzen. Bietet uns die Software 8 bit an, so heißt das, dass der Vorlagenumfang in Werte von 0 bis 255, also 256 Abstufungen umgesetzt werden kann. Bietet sie mehr Bits an, können die vorhandenen Tonwerte auf mehr Zahlen verteilt werden, was bedeutet, dass kleinere Unterschiede in der Vorlage auch als kleinere Unterschiede in der Datei sichtbar werden, dass also beim Scannen weniger Information verloren geht.
Üblicherweise geht man davon aus, dass 8 bit ausreichen, um Grauschattierungen zu erzeugen, die feiner sind als das, was das menschliche Auge noch unterscheiden kann. Dann entsteht der Eindruck eines kontinuierlichen Tonwertverlaufs. Daher auch die Beschränkung der Ausgabegeräte auf diese Bit-Tiefe.
Bei Farbvorlagen braucht man die 8 bit für jede der drei Grundfarben, die zugehörigen Dateien haben also 24 bit je Pixel. Ich werde im Folgenden also von 8/24- und 16/48-bit-Dateien reden und damit meinen, dass mit 8 bzw. 16 bit je Kanal (Grau oder RGB) und daher mit 24 bzw. 48 bit je Pixel gearbeitet wird. Andere Bit-Tiefen sind möglich (s.o.), aber vom Grundsatz her gilt dieselbe Argumentation, so dass ich nur über die Extremwerte reden werde.
Erklären möchte ich Ihnen im Folgenden, warum es sinnvoll ist, mit hohen Bitzahlen zu scannen und teilweise auch zu arbeiten, obwohl Ihr Drucker doch nur ein 8/24-bit-Ausgabegerät ist.
Offenkundige Vorteile von 16/48-bit-Dateien
Nach dem Vorstehenden ist klar, dass 16/48-bit-Dateien mehr nützliche Bildinformation enthalten.
Offenkundige Nachteile von 16/48-bit-Dateien
- 16/48-bit-Dateien benötigen doppelt so viel Platz auf Ihrer Festplatte und im Hauptspeicher Ihres Rechners.
- Software unterstützt 16/48-bit-Dateien gar nicht oder nur eingeschränkt.
Nicht gleich ersichtliche Vorteile von 16/48-bit-Dateien
Stellen wir uns vor, wir müssten den Bereich der Zahlen von 0 (Weiß) bis 1 (Schwarz) mit 10 Zahlen wiedergeben. Dann würden wir vielleicht folgende Zuordnung treffen:
Vorlagenwert wird dargestellt als Zahlenwert
|
Vorlagenwert |
wird dargestellt als |
Zahlenwert |
|
0 bis 0,1 |
-> |
0 |
|
0,1 bis 0,2 |
-> |
1 |
|
usw. bis |
|
|
|
0,9 bis 1 |
-> |
9 |
Von einer Vorlage, in der alle Werte zwischen Weiß und Schwarz vorkommen (Davon gehen wir im Folgenden immer aus.), erzeugen wir also zunächst eine Datei mit den Werten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Jetzt passen wir den Kontrast der Datei an, weil uns ein bestimmter Tonwertebereich besonders wichtig ist. Nehmen wir an, wir wollten den Kontrast um den Faktor 1,5 steigern, dann würden zunächst rein rechnerisch aus den vorhandenen Werten
|
alter Wert |
x 1,5 wird rechnerisch |
übrig bleibt aber nur der neue Wert |
|
0 |
0 |
0 |
|
1 |
1,5 |
2 |
|
2 |
3 |
3 |
|
3 |
4,5 |
5 |
|
4 |
6 |
6 |
|
5 |
7,5 |
8 |
|
6 |
9 |
9 |
|
7 |
10,5 |
9 |
|
8 |
12 |
9 |
|
9 |
13,5 |
9 |
Da uns nur die Werte von 0 bis 9 zur Verfügung standen, geht zunächst einmal alle Information verloren, die oberhalb von Tonwert 6 lag.
Anmerkung: Wenn man den Mittelbereich expandiert hätte, gäbe es Verluste in den niedrigen und hohen Werten, wenn man die hohen Werte expandiert hätte, bei den niedrigen Werten. Die Argumentation ist überall dieselbe, so dass ich mich hier auf einen Fall beschränke.
Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit: Wenn Sie sich jetzt einmal ansehen, welche Werte überhaupt noch auftauchen (rechte Spalte), werden Sie bemerken, dass nur noch 0, 2, 3, 5, 6, 8 und 9 vorkommen, d.h. statt der vorher vorhandenen 10 Tonwerte nur noch 7! Die Tonwerte 1, 4 und 7 kommen nicht mehr vor.
Wiederholen wir die Übung, stellen jedoch diesmal die vorhandenen Werte von 0 bis 1 als Zahlen von 0 bis 19 dar, also durch 20 Werte
|
Vorlagenwert |
wird dargestellt als |
Zahlenwert |
|
0 bis 0,05 |
-> |
0 |
|
0,05 bis 0,1 |
-> |
1 |
|
0,1 bis 0,15 |
-> |
2 |
|
usw. bis |
|
|
|
0,95 bis 1 |
-> |
19 |
und spielen wir wieder dasselbe Spiel, also die Kontrastanpassung x 1,5. Folgendes passiert nun:
|
alter Wert |
x 1,5 wird rechnerisch |
übrig bleibt aber nur der neue Wert |
|
0 |
0 |
0 |
|
1 |
1,5 |
2 |
|
2 |
3 |
3 |
|
3 |
4,5 |
5 |
|
4 |
6 |
6 |
|
5 |
7,5 |
8 |
|
6 |
9 |
9 |
|
7 |
10,5 |
11 |
|
8 |
12 |
12 |
|
9 |
13,5 |
14 |
|
10 |
15 |
15 |
|
11 |
16,5 |
17 |
|
12 |
18 |
18 |
|
13 |
19,5 |
19 |
|
14 |
21 |
19 |
|
15 |
22,5 |
19 |
|
16 |
24 |
19 |
|
17 |
25,5 |
19 |
|
18 |
27 |
19 |
|
19 |
28,5 |
19 |
Der Informationsverlust in den Werten ab 13 tritt auf wie bei der Darstellung mit 10 Zahlen, und auch in den unteren Werten kommen wieder ein paar Werte nicht vor. Also kein Gewinn?
Doch! Denn wenn wir jetzt die Darstellung durch 20 Zahlen auf eine mit 10 Zahlen herunterrechnen, wie wir es tun, wenn wir eine 16/48-bit-Datei zum Drucker schicken, bietet sich ein interessantes Bild: In der folgenden Tabelle sind in der linken Spalte die Werte, die in unserem Beispiel nach der Kontrastanpassung nicht mehr vorkommen, rot markiert. Wir müssen zum Herunterrechnen immer zwei benachbarte Werte zu einem zusammenfassen
|
alter Wert |
wird heruntergerechnet |
zu |
|
0 |
} |
0 |
|
1 |
||
|
2 |
} |
1 |
|
3 |
||
|
4 |
} |
2 |
|
5 |
||
|
6 |
} |
3 |
|
7 |
||
|
8 |
} |
4 |
|
9 |
||
|
10 |
} |
5 |
|
11 |
||
|
12 |
} |
6 |
|
13 |
||
|
14 |
} |
7 |
|
15 |
||
|
16 |
} |
8 |
|
17 |
||
|
18 |
} |
9 |
|
19 |
Wenn wir also zunächst mit vielen, fein abgestuften Werten arbeiten, dann den Kontrast anpassen und schließlich wieder auf die grobe Darstellung herunterrechnen, bekommen wir eine Darstellung, in der alleWerte vorhanden sind, also keine Löcher in der Skala auftreten.
Allerdings tritt eine andere Nebenwirkung auf: In der rechten Spalte des letzten Beispiels sind diejenigen Werte der am Ende resultierenden Darstellung blau markiert, bei denen bei der Zusammenfassung mehrere Werte auf einen Zielwert zusammengezogen wurden. Manche Werte werden also durch die Anpassung gegenüber den anderen bevorzugt, mit anderen Worten, überbewertet.
Was wir hier mit Zahlen zu Fuß gemacht haben, sieht man in Bildbearbeitungsprogrammen als Histogramm. Fehlende Tonwerte zeigen sich im Histogramm als Löcher, die überbewerteten Werte als so genannte Spikes, Nadelspitzen, die sich auffallend über die benachbarten Werte erheben.
Beispiele bieten die beiden nachfolgenden Histogramme: Bild 1 zeigt das Histogramm eines unbearbeiteten Bildes, wie es bei einer Aufnahme unter recht kontrastarmen Bedingungen im Automatikmodus von meiner Nikon Coolpix erzeugt wurde.
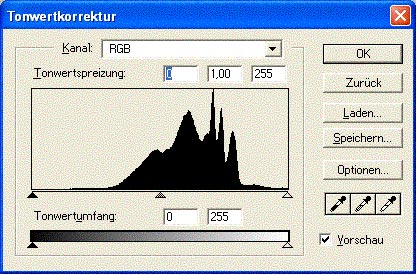
Es liegt nahe, die Tonwerte dieses Bildes auseinanderzuziehen, um die gesamte Skala zu füllen. So entstand das Histogramm in Bild 2. Hier sind im Bereich der Schatten ganz kleine Löcher und Spitzen zu erkennen, die allerdings noch nicht zu im Ausdruck sichtbaren Problemen führten.
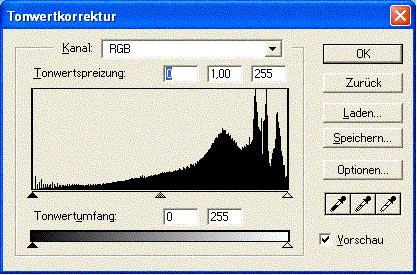
Löcher im Histogramm sind nicht automatisch ein Problem, zumal nicht, wenn sie nur bei einzelnen Tonwerten und nicht gehäuft in einem Tonwertbereich (Schatten, Mitteltöne oder Lichter) auftreten. Nehmen wir z. B. an, unser Auge könnte in der Größenordnung von 100 Tonwerten zwischen Schwarz und Weiß auflösen, und wir haben für die Darstellung 200 Tonwerte genutzt, dann würde es nicht einmal auffallen, wenn bei jedem zweiten Tonwert ein Loch im Histogramm wäre. Wenn aber an einer Stelle mindestens zwei benachbarte Tonwerte fehlen, dann kann das einen erkennbaren Sprung bedeuten.
Ob dieser Sprung tatsächlich erkennbar wird, hängt vom Bild ab. Ein Foto, bei dem keine flächigen Tonwertverläufe auftreten, ist i. Allg. weniger gefährdet, da dort von einem Pixel zum nächsten meist größere Sprünge auftreten, in denen der fehlende Tonwert "untergeht". Die beiden möglicherweise auftretenden Effekte heißen auf Neudeutsch Posterization und Banding, in Deutsch Farbsprünge und Farbbänder.
Als Posterization (oder Farbsprung) wird es bezeichnet, wenn ein an sich kontinuierlicher Tonwertübergang im Bild als ein abrupter, stufiger Übergang erkennbar wird.
(Beispiel: http://www.michaeldvd.com.au/Articles/VideoArtefacts/VideoArtefactsPosterization.html)
Banding (bzw. die Bildung von Farbbändern) wird besonders dann ein Problem, wenn im Bild großflächige Tonwertverläufe auftreten. Haben Sie z. B. einen Sonnenuntergang fotografiert, so klingt die Helligkeit vom Bild der Sonne her nach außen kontinuierlich ab. Banding führt dazu, dass kein kontinuierlicher Verlauf zustande kommt, sondern sich jeweils in sich einfarbige Ringe um die Sonne bilden, zwischen denen jedoch von einem zum nächsten abrupte Übergänge auftreten. Im Prinzip ist es dasselbe wie Posterization, nur wegen der Großflächigkeit noch störender.
|
|
Bild 3 zeigt den Effekt im Bereich des Himmels. |
Folgerungen
Schlussfolgerungen aus dem zuvor Gesagten sind folgende:
- Scannen Sie Vorlagen und Negative zunächst mit der größtmöglichen Bit-Tiefe, die Ihnen Ihr Treiber anbietet und die Ihre Bildbearbeitungssoftware verarbeiten kann.
- Führen Sie globale Tonwert- und Farbanpassungen mit den fein aufgelösten Daten durch.
- Ändern Sie dann erst den Modus auf 8/24-bit-Darstellung und führen die noch verbleibenden Änderungen durch.
Tonwertanpassung in der Scanner-Software oder Digitalkamera oder in der Bildbearbeitungssoftware?
Nicht nur die Bildbearbeitungssoftware, sondern auch Scannertreiber und hochwertige Digitalkameras bieten die Möglichkeit, globale Tonwertanpassungen durchzuführen. Wo sollte man zuschlagen?
I. Allg. ist es sinnvoll, möglichst viele Anpassungen schon auf der ersten Stufe, also Scanner/Kamera durchzuführen. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie Bildbearbeitungssoftware nutzen, die nur 8/24-bit-Daten verkraftet. Die Treibersoftware für Scanner/Kamera passt nämlich die "hochbittigen" Daten an und überträgt dann erst die 8/24-bit-Daten.
Verfügen Sie über Software, die 16/48-bit-Daten verarbeitet, ist es i. Allg. günstiger, in der Bildbearbeitungssoftware zu ändern, da Sie dort den großen Bildschirm Ihres Rechners und nicht nur den briefmarkengroßen Vorschau-Bildschirm der Scannersoftware oder Kamera nutzen können. In diesem Fall würde ich Ihnen also raten, nur die allergröbsten Anpassungen über Scanner/Kamera vorzunehmen, aber die Feinarbeit in der Bildbearbeitungssoftware zu erledigen.
Ungleiche Brüder
Orthopanchromatische Filme:
MACO PO 100c und Fuji Neopan 100 Acros
Thomas Wollstein
April 2003
Im November letzten Jahres (Antwort auf die Frage...) hatte ich den orthopanchromatisch sensibilisierten MACO PO 100c als einzigartigen Film beschrieben, und als Fuji die Einführung des Fuji Neopan 100 Acros ankündigte, dachte ich zunächst, ich müsste mein Statement von damals revidieren, da es ab April 2003 zwei orthopanchromatische Filme auf dem deutschen Markt geben soll. Um es vorwegzunehmen: Ich muss mein Statement nicht revidieren. Nach meinem Verständnis ist der Fuji Neopan 100 Acros nicht wirklich orthopanchromatisch sensibilisiert. Doch dazu unten mehr.
Sensibilisierungen von SW-Material:
Was heißt ortho-, pan- oder orthopanchromatisch?
Silbersalze sind a priori nur für Licht recht kurzer Wellenlängen (UV und Blau) empfindlich. Die ersten Fotomaterialien sprachen daher nur auf solches Licht an und konnten unter rotem (langwelligem) Licht verarbeitet werden. Sie gaben Blaues zu hell und alles Andere zu dunkel oder gar völlig schwarz wieder. "Zu dunkel" heißt "dunkler als nach unserem menschlichen Empfinden der Grauwert zu dieser oder jener Farbe sein sollte". Angestrebt wurde immer schon eine möglichst "realistische", will sagen: empfindungsgerechte Umsetzung der Farben in Grauwerte.
Die Defizite der Sensibilisierung des Silbersalzes wurden durch Beimischung von Farbstoffen zur Emulsion ausgeglichen, die den Empfindlichkeitsbereich zu längeren Wellen hin erweiterten. Ein früher Schritt waren so genannte orthochromatische Emulsionen. "Ortho" kommt aus dem Griechischen und heißt "richtig", "chroma" ist "die Farbe". Die orthochromatischen Filme waren also "richtig farbempfindlich" – nach damaligem Verständnis. Heute würden wir höchstens sagen, dass sie besser waren als ihre Vorgänger, denn nach wie vor ist orthochromatisches Material im Bereich des roten Lichts völlig blind. Wenn ich also meine Tochter mit roter Jacke, blauer Strumpfhose und schwarzen Schuhen auf orthochromatischem Material abbilde, ist die Jacke (selbst wenn sie gerade aus der Waschmaschine kommt) im Foto so schwarz wie die Schuhe, also ziemlich weit am Farbempfinden vorbei. Entsprechend kann man Ortho-Material auch unter Rotlicht verarbeiten. Beispiele für solches Material sind Dokumentenfilme wie MACO Ort 25c, Lith-Filme für grafische Zwecke und Ilford Ortho Plus Planfilm für bildmäßige Anwendungen.
Lange Zeit galten panchromatische Filme als der Weisheit letzter Schluss. Ihr Empfindlichkeitsbereich erstreckt sich bis hin zu rotem Licht und ist so beschaffen, dass die zitierte rote Jacke mittel- bis hellgrau wiedergegeben wird, wie ich es auch als angemessen empfinde. Da panchromatische Filme auch rotes Licht "sehen", muss man sie in absoluter Dunkelheit verarbeiten. Die überwiegende Mehrheit der heute verkauften SW-Filme sind Pan-Filme.
Auftritt der orthopanchromatischen (oder auch rectepan) Filme. Orthopan-Filme sind keine neue Erfindung: Nachdem bei frühen Pan-Filmen die Rot-Wiedergabe als zu hell empfunden wurde, gab es auch Filme, die nicht ganz so rotempfindlich waren, aber schon Rot und Schwarz unterscheiden konnten. Diese wurden dann eben als "richtig panchromatisch" (orthopan oder rectepan, die erste Version, für die, die an der Schule Altgriechisch gelernt haben, die zweite für die Lateiner) bezeichnet. Diese Filme waren zeitweise sehr beliebt, speziell, so habe ich inzwischen gelernt, auch für Porträtaufnahmen, denn sie gaben nicht ganz so rote Lippen etwas dunkler und damit voller wieder, ohne dass sie Hautunreinheiten (Rötungen) zu sehr betonten. Die typischen Charakteristika von Orthopan-Filmen sind folgende:
- Rot und Schwarz werden unterschieden, doch Rot wird deutlich dunkler wiedergegeben als bei Pan-Filmen.
- Da das blaue Licht im Verhältnis mehr zur Belichtung beiträgt (weil eben das rote teilweise wegfällt), werden harte Schatten (die vom blauen Himmel als "Reflektor" ausgeleuchtet werden) ein wenig aufgehellt.
- Bei Porträtaufnahmen werden Lippen etwas dunkler wiedergegeben. Man kann also evtl. auf Lippenstift verzichten oder ihn eine Nummer heller wählen.
- Hautunreinheiten werden nicht (wie bei Ortho-Filmen) über Gebühr betont.
- Dunst und Luftperspektive werden etwas betont. (Unter "Luftperspektive" versteht man die durch Streuung vorwiegend blauen Lichts zunehmende Aufhellung von Details, je weiter diese vom Aufnahmestandpunkt entfernt sind. Wenn Sie hintereinander liegende Bergketten aufnehmen, wird jede weiter entfernt liegende etwas heller und bläulicher wiedergegeben. Das verleiht dem Bild Tiefe.)
- Blauer Himmel wird etwas heller wiedergegeben.
Dank der Tatsache, dass frühe fotografische Bilder auf im Trend eher orthochromatischem Material aufgenommen wurden, haben Fotos aus Ortho-Filmen und im Ansatz auch solche auf Orthopan-Filmen mitunter einen leicht nostalgischen Hauch. Die meisten der oben aufgezählten Punkte – vielleicht mit Ausnahme von (6) – sind durchaus wünschenswert. Dennoch: Vor einigen Jahren waren Orthopan-Filme praktisch ausgestorben.
Die Kontrahenten: MACO PO 100c und Fuji Neopan 100 Acros
MACO PO 100c
Vor rund vier Jahren kam mit dem MACO PO 100c wieder einmal ein Orthopan-Film auf dem Markt. Dass der damalige Start missglückte, lag nicht etwa an fehlender Akzeptanz (Fans hatte der Film sofort eine Menge.), sondern daran, dass der nötige Sensibilisierungsfarbstoff von einem Monopolisten angeboten wurde, der nach einiger Zeit so unverschämte Preise verlangte, dass niemand den Film mehr hätte kaufen wollen. MACO brauchte einige Zeit, um eine neue, weniger unverschämte Quelle für den Rohstoff aufzutun, und der MACO PO 100c kam wieder, und jetzt, ab April 2003, soll er lt. Fuji mit dem Fuji Neopan 100 Acros ein Brüderchen bekommen.
Dass ich den MACO PO 100c sehr schätze, habe ich Ihnen, liebe Leser, schon im November letzten Jahres verraten. Nach den ersten Tests im letzten Urlaub in Frankreich war ich zunächst von den Socken über den Detailreichtum und die Tonwertwiedergabe bei den aufgenommenen Landschaften und Innenaufnahmen. Die Aufnahmen gefielen mir so gut, dass ich mich erst einmal geärgert habe, dass ich kurz vorher noch so viele Ilford Delta 100 auf Halde gelegt hatte, weil das bis dahin mein Universalfilm war.
Probleme mit zu hell wiedergegebenem Himmel hatte ich bisher keine. Man kann den MACO PO 100c prima mit einem Gelbfilter (Belichtungskorrektur plus ½ bis 1 Blende) oder einem Orangefilter (plus 1 bis 2 Blenden) benutzen. Dabei gehen allerdings viele der Charakteristika der Sensibilisierung verloren. Der Film reagiert dann näherungsweise wie ein Pan-Film ohne Filter. Ein Rotfilter #29 (dunkelrot) führt erwartungsgemäß auch bei Anwendung der bei Pan-Filmen üblichen Korrektur von plus 3 Blenden zu fast blanken Negativen, ist also in aller Regel nicht empfehlenswert.
(Als Anmerkung am Rande sei darauf hingewiesen, dass man die Sensibilisierung eines Ortho- oder Orthopan-Films natürlich auch näherungsweise durch einen Pan-Film mit Blaufilter simulieren kann.)
Neben den typischen Eigenschaften von Orthopan-Filmen, die ich oben schon aufgezählt habe, lässt sich zum MACO PO 100c noch folgendes Kurzprofil geben:
- Empfindlichkeit: Nennwert oder leicht höher, d.h. ISO 100/21°. (Beachten Sie aber den Hinweis weiter unten zu verschiedenen Lichtarten!)
- feines bis sehr feines Korn
- sehr hohes Auflösungsvermögen, Nennwert rund 260 Lp/mm (Zum Vergleich: Nennwert für Ilford Delta 100 sind 160 Lp/mm, Nennwert für Kodak T-max 100 sind 200 Lp/mm) » immenser Detailreichtum
- glasklarer Träger (wasserlösliche Lichthofschutzschicht, durch Vorwässerung zu entfernen) » prädestiniert für Umkehrentwicklung
- Trägermaterial: Triazetat bei KB, PE beim Mittelformat » PE ist absolut archivfest!
- sehr hohe Maximaldichte (wichtig für Umkehrentwicklung, zum Vergleich: MACO PO 100c 4,34, Agfa Scala 3,8) » ebenfalls ein wichtiger Punkt für Umkehrentwicklung
Fuji Neopan 100 Acros
Nachdem ich schon eine Weile mit dem MACO PO 100c herumgespielt hatte, ließ mich die Nachricht, dass Fuji im April 2003 mit dem Acros einen Film mit ähnlichen Kennwerten auf den europäischen Markt bringen wollte, aufhorchen. Anfang März bekam ich die ersten Testmuster des Films in die Finger. Auch zu diesem Film ein Kurzprofil analog zum MACO PO 100c:
- Empfindlichkeit: Nennwert oder leicht höher, d.h. ISO 100/21°.
- feines bis sehr feines Korn
- hohes Auflösungsvermögen, Nennwert rund 200 Lp/mm » guter Detailreichtum
- grau eingefärbter Träger » für Umkehrentwicklung nicht oder nur bedingt geeignet
- Trägermaterial: Triazetat
Die Filme im Vergleich
Die Testbedingungen
Um die Filme vergleichen zu können, lud ich zwei Nikon-FM-Gehäuse, eines mit dem MACO, eines mit dem Fuji und nutzte einen sonntäglichen Spaziergang, um eine Reihe von Aufnahmen parallel zu schießen, um sie später zur Auswertung nebeneinander anzuschauen. Die Aufnahmen wurden dabei immer innerhalb weniger Minuten unter gleichen Lichtverhältnissen, mit demselben Objektiv und mit denselben Einstellungen für Zeit und Blende gemacht, in den meisten Fällen vom Stativ und mit Spiegelvorauslösung, damit eventuelle Schärfeunterschiede zwischen einem Aufnahmenpaar wirklich sicher auf Unterschiede in den Filmen zurückgeführt werden konnten.
Als Amateur, der mit der Fotografiererei kein Geld verdient, also tagsüber für seine Brötchen (und auch Filme) einen normalen Job erledigen muss, und angesichts der Deadline für diesen Artikel (Ich wollte ihn zur Markteinführung des Acros im April fertig haben.), blieb nicht die Zeit, mit vielen verschiedenen Film-Entwickler-Kombinationen herumzuspielen oder lange zu testen. Ich entwickelte daher den MACO PO 100c mit der erprobten Zeit im bewährten LP-SUPERGRAIN und den Fuji Neopan 100 Acros in Ilfotec HC, einem bewährten Entwickler für alle Fälle, dem Ilford in vielen seiner Datenblätter "best overall image quality", also die insgesamt beste Bildqualität attestiert. Im Datenblatt des Acros werden Entwicklungszeiten für Kodak HC-110 Dil. B angegeben. HC-110 ist mit Ilfotec HC praktisch gleichwertig, und Dil. B entspricht beim Ilfotec HC der Verdünnung 1+31. Die gemessene Schwärzungskurve bei Entwicklung nach den Vorgaben im Fuji-Datenblatt war hinreichend genau die für eine N-Entwicklung.
Die Ergebnisse
Beide Filme lieferten sehr detailreiche und hoch aufgelöste Aufnahmen mit feinem bis sehr feinem Korn.
Das waren aber überraschenderweise auch schon die Parallelen.
Wie schon erwähnt, unterscheiden sich die Träger der beiden Filme. Während MACO seit längerem auf glasklares Trägermaterial und eine wasserlösliche Lichthofschutzschicht setzt, nutzt Fuji den bei den meisten Filmen üblichen grau bis leicht blaugrau eingefärbten Träger. Im direkten Vergleich weist der Träger allein beim Fuji schon eine um rund 0,18 höhere Dichte auf.
Wenn ein Film A eine Trägerdichte von 0 hätte und Film B eine von 0,3, und die Negative wären ansonsten gleich, so müsste man bei Film B beim Vergrößern schlicht doppelt so lange belichten wie bei Film A, um dasselbe Ergebnis zu bekommen. Die Dichte des Trägers wird daher i.d.R. als einigermaßen wertneutraler Aspekt eines Films betrachtet. Ich persönlich habe allerdings klare Träger aus zwei Gründen schätzen gelernt: Einerseits fällt es mir persönlich leichter, die Schattendichten von Filmen auf klarem Träger visuell auszuwerten, andererseits arbeite ich gerne mit langsamen Papieren (wie z. B. Forte Polywarmtone) und insbesondere nach dem Lith-Verfahren. Langsame Papiere verlangen sowieso schon lange Belichtungszeiten (typischerweise um die 30 s bei 20x25 cm), und das Lith-Verfahren verlangt Überbelichtung um zwei bis drei Blenden (Zeiten bis zu 4 Minuten!). Dazu jetzt noch eine halbe bis eine Blende, und ich kann auf meinem Vergrößerer Eier braten, von der Erwärmung des Negativs (Sprung der Schärfeebene), den Auswirkungen auf die Lebensdauer der Lampe und der langweiligen Wartezeit ganz zu schweigen.
Noch ein Wort zum Sprung der Schärfeebene: Ich hab's nie nachgemessen, aber nach meinem Verständnis muss ein Negativ um so wärmer werden, je mehr Licht es schluckt. Ein glasklarer Träger schluckt weniger Licht und braucht kürzere Belichtungszeiten. Sehen Sie, worauf ich hinaus will?
Letztendlich prädestiniert der klare Träger den PO 100c für die Umkehrentwicklung. Dazu ein paar Bemerkungen am Ende dieses Artikels.
Größe und Qualität des Korns sind bei meinem Test wegen der verschiedenen Entwickler nur eingeschränkt vergleichbar. Unterschiede können zumindest teilweise auf die beiden Entwickler zurückzuführen sein. Der LP-SUPERGRAIN ist ein sehr kantenscharf und ausgleichend arbeitender Entwickler, kein Feinkornentwickler. Ilfotec HC auf der anderen Seite liefert einen guten Kompromiss aus Schärfe und feinem Korn. Es war also keine große Überraschung, dass beim MACO PO 100c das Korn eine Spur grober war als beim Fuji Neopan 100 Acros. Darüber hinaus war es beim PO 100c scharf akzentuiert und beim Acros leicht verwaschen. Im Gesamteindruck wirkten daher bei feinem bis sehr feinem Korn bei beiden Filmen die Aufnahmen auf dem PO 100c schärfer, die auf dem Acros etwas weniger körnig.
Die Schwärzungskurven der Filme unterscheiden sich signifikant: Die des PO 100c in LP-SUPERGRAIN hat die typische S-Form, d.h. der Kontrast nimmt in den Lichtern ab, wodurch diese feinabgestuft und im Bereich printbarer Dichten bleiben. (Ich habe schon an anderer Stelle erläutert, dass in den Lichtern im Positiv weniger Dichtedifferenz im Positiv, damit auch weniger Kontrast als in den Schatten nötig ist, um zwei benachbarte Grauwerte zu unterscheiden.) Die Kurve des Acros in Ilfotec HC bleibt bis mindestens Zone XII praktisch linear. Dadurch bleibt auch in sehr hohen Lichtern eine Differenzierung erhalten, die aber bei so hohen Dichten liegt, dass sie nur mit extensiver Nachbelichtung im Positiv genutzt werden kann.
Die Schwärzungskurve ist zwar ebenfalls eine Eigenschaft der Kombination aus Entwickler und Film, doch zeigen Vergleichstests eines Freundes, dass dieses Verhalten der Filme auch bei Entwicklung beider in demselben Entwickler auftritt.
Die Überraschung kam bei der Untersuchung der Sensibilisierung der Filme. In dem Wissen, dass der PO 100c ein Orthopan-Film ist, also einer, dessen Rotempfindlichkeit deutlich geringer ist als bei Pan-Filmen, hatte ich schon vor einiger Zeit beim PO 100c einen direkten Vergleich gemacht, d.h. auf einen Film eine Belichtungsreihe einer Graukarte von Zone 0 bis Zone X erst bei diffusem Tagelicht und dann bei Halogenlicht aufgenommen (ähnlich wie beim CUBE 400c, siehe Filmempfindlichkeit, der im Roten empfindlicher ist als Pan-Filme) und tatsächlich: Der MACO PO 100c ist bei Glühlampenlicht erwartungsgemäß eine Blende langsamer als bei Tageslicht. Das müssen Sie unter entsprechenden Bedingungen einplanen! Es ist vernünftig, bei Kunstlichtaufnahmen sowie bei schon deutlich gelblich-rotem Licht in den Abendstunden den MACO PO 100c um eine Blende reichlicher zu belichten, also wie ISO 50/18°.
Gleiches hätte ich beim Acros erwartet, da er auch als Orthopan-Film ausgewiesen ist. Ich habe daher meinen üblichen Test gemacht und auf demselben Film eine Belichtungsreihe mit Graukarte bei diffusem Tageslicht und bei Halogenlicht aufgenommen (unter exakt denselben Bedingungen wie beim PO 100c) und – Da staunte ich nicht schlecht! – beide Kurven deckten sich exakt. Es lag nahe, an einen Messfehler zu glauben, und da kam es mir sehr gelegen, dass ein Freund mit entsprechender technischer Ausstattung sich anbot, die Spektren der beiden Filme zu bestimmen. Tatsächlich zeigte seine Auswertung, dass der Empfindlichkeitsbereich des Acros sich um satte 50 nm weiter in den roten Bereich hinein erstreckt als der des PO 100c. Während die Empfindlichkeit des Acros erst bei 640 nm in den Keller geht und sogar bis rund 720 nm noch nachweisbar ist, knickt die Kurve des PO 100c schon bei rund 580 nm deutlich ab, und bei vielleicht 630 nm ist Schluss. Letztendlich habe ich die im Datenblatt des Acros angegebene Kurve des Acros noch mit der von Kodak für den T-max 100 angegebenen verglichen und fand, dass beide praktisch gleich waren. Kein Wunder also, dass der Acros bei Halogenlicht dieselbe Empfindlichkeit hat wie bei Tageslicht!
Der Unterschied in der Sensibilisierung zwischen dem Acros und einem üblichen Pan-Film ist daher sehr gering. Entsprechend wenig akzentuiert fallen die weiter oben beschriebenen typischen Effekte der orthopanchromatischen Sensibilisierung aus. Aus meiner Sicht ist der Acros daher nichts Besonderes.
... mit einer Ausnahme: Das Datenblatt des Acros attestiert diesem Film ein hervorragendes Reziprozitätsverhalten, d.h. bis hin zu gemessenen Belichtungszeiten von 120 s soll kein nennenswerter Reziprozitätsfehler auftreten, darüber soll eine Korrektur von 1/2 Blende ausreichen. Für Leute, die häufiger mit solch niedrig empfindlichen Filmen Nachtaufnahmen schießen, bietet das einen erheblichen Zeitgewinn. Eine Nebenwirkung des Reziprozitätsfehlers ist auch eine Aufsteilung des Negativkontrasts, da die Schatten durch den Reziprozitätsfehler mehr beeinträchtigt werden als die Lichter. Den Acros habe ich allerdings noch nicht bei Nachtaufnahmen getestet. Mit dem PO 100c, den es schon seit einem halben Jahr gibt, habe ich dagegen schon Nachtaufnahmen gemacht. Sein Reziprozitätsfehler liegt im Rahmen dessen, was man von anderen Filmen kennt. Bei den Bildbeispielen am Ende des Artikels finden Sie als Beispiel eine Aufnahme, die ich mit einer Belichtungszeit von sage und schreibe 15 min gemacht habe. Für die Aufnahme hatte ich eine Lichtmessung am Fuß der Statue vorgenommen und diese nach einer allgemeinen Tabelle der Royal Photographic Society korrigiert, die Andrew Sanderson in seinem Buch "Night Photography" zitiert. Probleme mit Aufsteilung hatte ich keine wesentlichen, dabei war der Bereich der Treppe im Vordergrund wirklich sehr düster. Ich vermute, hier kommt dem PO 100c seine S-förmige Schwärzungskurve (im Gegensatz zur langen, geraden Kurve des Acros) zugute.
Umkehrentwicklung: Der MACO PO 100c als Diafilm
Der Agfa Scala hat sich einen guten Namen als SW-Diafilm gemacht und erfreut sich großer Beliebtheit. Nach Tests des Fachlabors Dormoolen in Hamburg scheint es so zu sein, dass der PO 100c die schon hohe Qualität des Scala noch übertrifft. Nach Testergebnissen von Dormoolen, die ich auf Anfrage über MACO erhalten habe, übertrifft die Maximaldichte des MACO PO 100c die des Agfa Scala noch um gut 0,5 Dichteeinheiten. Die nutzbare Empfindlichkeit beträgt ISO 125/22°. Dormoolen in Hamburg und auch andere Labors, z. B. ZEBRA in Wien bieten ab sofort auch die Umkehrentwicklung des MACO PO 100c an.
Fazit
Der Fuji Neopan 100 Acros ist ein toller Film, der außerordentlich hoch aufgelöste, detailreiche und feinkörnige Aufnahmen erlaubt. Die Unterschiede zu einem üblichen Pan-Film wie etwa Ilford Delta 100 oder Kodak T-max 100 sind aber äußerst gering. Ein Orthopan-Film ist er nach meinem Verständnis des Terms nicht.
Der MACO PO 100c ist wirklich ein orthopanchromatischer Film, der im roten Spektralbereich deutlich weniger empfindlich ist als Pan-Filme. Er zeigt daher bestimmte Effekte, die der Fuji Neopan 100 Acros nicht zeigt.
Der Begriff "orthopanchromatisch" ist nicht genormt. Von daher ist es vielleicht kein Etikettenschwindel, was Fuji hier betreibt, sondern nur ein Versuch, den Film durch dieses Attribut interessanter zu machen.
Meinen November-Artikel brauche ich also in einer Hinsicht nicht zu korrigieren: Der MACO PO 100c wird auch nach der Markteinführung des Fuji Neopan 100 Acros ein in seinen Eigenschaften einzigartiger Film (und mein Lieblingsfilm) bleiben.
Bildbeispiele, aufgenommen auf MACO PO 100c
Bitte beachten Sie, dass es keinen Sinn macht, die Bilder in vergrößerter Ansicht zu betrachten, da Sie, um die Downloadzeiten auch für Modemverbindungen im erträglichen Rahmen zu halten, nur geringe Auflösung aufweisen. Auch die Tonwertwiedergabe ist bei Betrachtung auf dem Monitor nur begrenzt getreu. Ihr Monitor ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anders kalibriert als meiner. Die Bildbeispiele dienen daher nur zur qualitativen Veranschaulichung der erwähnten Punkte.
Farbwiedergabe
|
|
|
Detailreichtum
|
|
|
"Schneeglöckchenspur". Wenn Sie Spaß dran haben, können Sie (wenn auch nicht in der Web-Variante des Bildes und auch nur eingeschränkt im Detailscan) die Grashalme zählen. Der Ausschnitt gibt die Partie in der linken Spur, etwa 1/3 ins Bild hinein, wieder und wurde mit 2900 DPI vom Negativ gescannt. (KB-Aufnahme vom Stativ mit Spiegelvorauslösung, Nikon FM, PC-Nikkor 3,5/28 mm, 1/15 s)
Luftperspektive
|
|
Deichkrone am Fuß der Düsseldorfer Südbrücke auf der Neusser Rheinseite |
|
|
Düsseldorfer Rheinpanorama im Gegenlicht |
Nachtaufnahme
|
|
|
- Kunst und Wissenschaft -
Die Schwärzungskurve in Theorie und Praxis
Thomas Wollstein
März 2003
Laufen Sie nicht gleich weg! In diesem Artikel möchte ich Ihnen die Grundlagen der Sensitometrie nahebringen.
Sie sollten mich doch kennen: Ich lege Wert auf Praxisbezug. Ich werde Sie also nur in dem Maße mit Kurven langweilen, wie ich das für das Verständnis für unvermeidbar halte, Ihnen aber die wichtigsten Schlussfolgerungen für die Praxis in Kochrezept-Form an die Hand geben.
Das meiste von dem, was ich Ihnen vermitteln möchte, hat die Mehrzahl aller Fotografen vielleicht schon auf die eine oder andere Weise gehört, aber häufige Fragen im Hobbylaborforum zeigen, dass die Schlussfolgerungen für die Praxis doch nicht immer so offen auf der Hand liegen.
Befassen will ich mich in diesem Artikel mit
- Filmempfindlichkeit
- Kontrast
- Pushen/Pullen
- Ausgleichsentwicklung
- Belichtungsmessung
Noch eine Anmerkung in eigener Sache: Sehen Sie mir nach, dass ich für diesen Beitrag nicht sehr professionell aussehende Handskizzen als Abbildungen verwende. Ich bin (mal wieder) froh, diesen Artikel rechtzeitig zum Monatsende fertig zu haben. Die Zeit, die ich gebraucht hätte, um die Bilder auch noch EDV-technisch umzusetzen, war einfach nicht mehr übrig. Wichtig war mir der Inhalt, und ich denke, der kommt rüber.
Was ist Sensitometrie?
Ferdinand Hurter und Vero Driffield wird der folgende Ausspruch zugeschrieben:
"Die Erzeugung eines perfekten Bildes durch Photographie ist eine Kunst;
die Erzeugung eines perfekten Negativs ist eine Wissenschaft."
Wer, zum Teufel, sind Ferdinand Hurter und Vero Driffield? Diese beiden, der eine Chemiker, der andere Ingenieur, machten sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts daran, eine der Grundlagen der Fotografie, die Sensitometrie, zu erforschen und zu beschreiben. Nach 10 Jahren intensiver Forschung traten sie 1890 mit der ersten H&D-Kurve, heute besser bekannt als Schwärzungskurve, an die (Fach-)Öffentlichkeit und legten damit den Grundstein für die Belichtung, etwas, das vorher rein "aus dem Bauch heraus", nach Erfahrung und Glück gehandhabt wurde. Der bekannteste Fotograf unter denen, die sich später über die Erkenntnisse von Hurter und Driffield hermachten und sie weiter ausarbeiteten, dürfte wohl Zonensystem-Prophet Ansel Adams sein.
Regelmäßigen Lesern meiner Kolumne brauche ich vermutlich nicht zu versichern, dass ich kein Verfechter der strengen Anwendung des Zonensystems bin, insbesondere nicht bei der Kleinbildfotografie, aber als ein solcher wissen Sie auch, dass ich Wert auf praktikable, aber saubere Technik lege. Nach meinem Empfinden kann man ohne einen gewissen Grundschatz an technischer Fertigkeit gute Fotos nur in Glücksfällen erzeugen. Es gibt Fotografen - der von mir sehr geschätzte Henri Cartier-Bresson ist deren einer - die von sich behaupten, sie hätten von Technik keine Ahnung, und die trotzdem Fotos erzeugen, von denen ich mit all meinen technischen Kenntnissen mitunter nur träumen kann. Ich denke, das liegt nur daran, dass diese Menschen so viele Fotos gemacht haben (und auch so viele Fehler), dass sie die Technik so auf einem unterbewussten Niveau verinnerlicht haben, dass sie nicht mehr drüber nachdenken müssen. D.h. aber auch, dass sie sie "beherrschen". Ein Seiltänzer z.B. muss nicht viel von Dreh- und Trägheitsmomenten verstehen verstehen, um auf dem Seil spazieren zu können, aber mit ein paar Grundkenntnissen der Mechanik und etwas Geduld kann man als motorisch nicht völlig unbegabter Mensch schnell auch auf einem Seil zu gehen lernen, schneller vielleicht als ein Akrobat, der vom Mechanik keine Ahnung hat. Versteht der Seiltänzer das, was er tut, auch auf abstrakter, technischer Ebene, kann er sich nach meinem Verständnis viel effizienter zu wahrer Meisterschaft entwickeln.
Gut, damit habe ich wohl hinlänglich ausgeführt, warum ich meine, Sie sollten als Fotograf, auch wenn Sie kein "Zonie" sind, ein paar technische Grundlagen beherrschen. Steigen wir also ein.
Grundlagen
Schwärzungskurve, Kontrast, Empfindlichkeit
Die Antwort des Materials auf Belichtung wird beschrieben durch die Schwärzungskurve, im Englischen auch oft "H&D curve" genannt. Sie ist der zentrale Baustein der Sensitometrie. Viele Fotografen haben zumindest schon einmal solche Kurven gesehen, z.B. in Datenblättern, und wissen daher qualitativ, wie sie aussieht: dass sie flach anfängt, einen mehr oder weniger linearen Mittelteil hat und schließlich wieder abflacht. Bild 1 zeigt eine solche idealisierte Kurve.
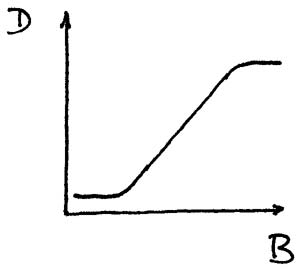
Aber was bedeutet das für die tägliche Fotopraxis?
Wenn die Schwärzungskurve an einer Stelle flach verläuft, heißt das, dass dort eine bestimmte Belichtung, nennen wir sie B1, und eine sich davon unterscheidende Belichtung, B2, dieselbe Dichte D zur Folge haben. Wenn wir also zwei Stellen in einem Motiv vor der Kamera haben, und unser Belichtungsmesser zeigt uns verschiedene Helligkeiten an, aber wir belichten so, dass beide in einem flachen Teil der Kurve auf den Film gebannt werden, wären die beiden entsprechenden Stellen im Bild ununterscheidbar.
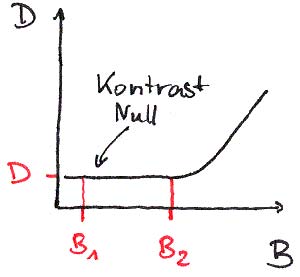
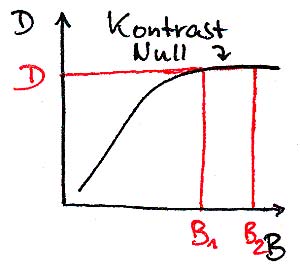
Belichten wir aber so, dass die beiden Stellen im linearen Teil der Kurve liegen, so werden die beiden unterschiedlichen Belichtungen unterschiedliche Dichten erzeugen, und die Dichtedifferenz hängt von der Steigung des linearen Teils der Kurve ab.
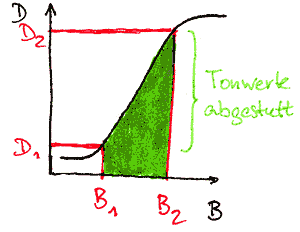
Wir merken uns also:
Die Steigung der Schwärzungskurve bestimmt den Kontrast der Wiedergabe im Negativ.
Wir betrachten unser Beispiel aber noch ein Stück weiter: Wir stellen uns ein Motiv vor, bei dem wir mittels des Spotbelichtungsmessers festgestellt haben, dass zwischen den tiefsten Schatten und den hellsten Lichtern, die wir jeweils noch mit Zeichnung wiedergeben wollen, 5 Blenden Helligkeitsdifferenz liegen. Je nachdem, wie wir dieses Motiv belichten, können wir verschiedene Effekte erzielen:
- Wir belichten so, dass der gesamte Bereich im linearen Teil der Kurve liegt. Das ist bei 5 Blenden Helligkeitskontrast i.Allg. kein Problem. Es werden dann alle Tonwerte des Motivs differenziert wiedergegeben.
- Wir wollen die Schattenzeichnung "verstecken", d.h. die Schatten sollen schwarz zulaufen, weil sie störendes Detail enthalten. Dann belichten wir so, dass die Schatten im flachen Teil der Kurve liegen. Wir nutzen dann die Kurve nicht ganz nach oben aus. (Dazu später mehr.)
- Wir wollen die Lichterzeichnung "verstecken". Wie das geht, können Sie jetzt schon erraten.
Also noch etwas zum Merken:
Bei gegebenem Kontrastumfang entscheidet die Belichtung, welche Teile der Tonwertskala bei gegebenem Kontrast abgestuft wiedergegeben werden.
Was aber tun, wenn ich nun ein Motiv habe, das einen Helligkeitsumfang von 6 oder 7 Blenden hat, und mir ist eine abgestufte Wiedergabe im gesamten Bereich wichtig? Das Motiv können wir oft nicht beeinflussen, also müssen wir die Kurve verbiegen, den Kontrast senken.
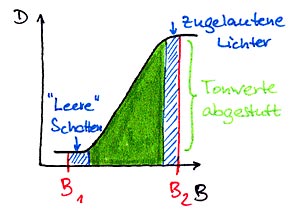
Der selektiven Verringerung des Kontrasts in den Schatten durch Vorbelichtung habe ich schon einen eigenen Artikel gewidmet. Hier geht es mir um die Verringerung der Steigung der Schwärzungskurve durch Verkürzung der Entwicklung. Eine Änderung der Entwicklungszeit wirkt sich abhängig von der belichteten Silbermenge aus, und das heißt, dass eine Verkürzung der Entwicklung die Lichter viel stärker zurückhält als die Schatten. Die Kurve wird also flacher. Plötzlich passen statt 5 Blendenstufen 6 oder gar 7 in den linearen Teil. Allerdings steht pro Blendenstufe ein geringerer Dichteumfang zur Verfügung, denn der Gesamtbereich bleibt weitgehend gleich. Die Zonensystem-Adepten nennen das eine N-1-Entwicklung (sprich: N minus 1), wenn so entwickelt wird, dass eine Blende mehr in den durchgezeichneten Bereich passt.
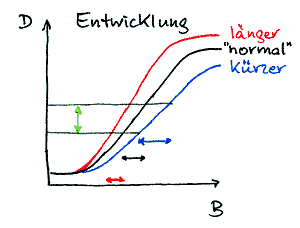
Bild 6 illustriert das: Der rote, der schwarze und der blaue Doppelpfeil stellen Kontrastumfänge dar, der grüne einen festen Dichteumfang. Man sieht deutlich, dass bei der kürzeren Zeit ein größerer Kontrastumfang in denselben Dichteumfang übersetzt wird.
Was tut die Entwicklungszeit an der Empfindlichkeit des Films?
Nach DIN ISO 6 (der deutschen Fassung der geltenden ISO-Norm zur Bestimmung der Empfindlichkeit von Filmmaterial) wird die Empfindlichkeit eines Films durch die Belichtung bestimmt, die eine Schwärzung mit einer Dichte von 0,1 über dem Grundschleier und der optischen Dichte des Trägers (engl.: film base plus fog oder fb+f) hervorruft. Wenn Sie die Entwicklung verkürzen, werden bei gleichbleibender Belichtung alle Dichten etwas geringer ausfallen, auch die geringen. Aber: Die geringen Dichten werden – das klang oben schon an – nur wenig beeinflusst, die hohen Dichten hingegen kräftig. Die Empfindlichkeit des Films nimmt also durch verkürzte Entwicklung nur geringfügig ab, meist innerhalb eines Bereichs von nur 1/3 Blende. Das zeigt Bild 7. Die Steigung des geraden Teils der Kurve, also der Kontrast, nimmt mit längerer Entwicklung zu, aber am Kurvenfuß tut sich wenig.
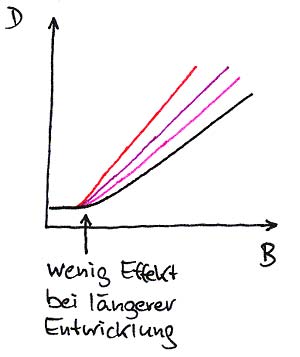
Umgekehrt kann es natürlich auch vorkommen, dass mein Motiv nicht sehr kontrastreich ist. Dann habe ich das, was oft "Belichtungsspielraum" genannt wird. Ob ich mein Motiv eine Blende reichlicher oder knapper belichte, macht für die Tonwertwiedergabe nichts aus, da ich immer noch im linearen Bereich der Kurve bleibe. Es macht aber etwas für die Negativqualität aus! Die Körnigkeit ist um so geringer, je knapper ich belichtet habe, die Schärfe um so besser. Die Regel ist also:
Belichte so reichlich wie nötig, aber so knapp wie möglich!
Jetzt kann ich in der Duka eine härtere Gradation nehmen und die Dichtedifferenzen im flauen Negativ auseinanderzerren. Das ist insbesondere die beste Lösung, wenn auf demselben Film flaue und kontrastreiche Motive abgebildet sind. Ich kann aber auch die Steigung der Kurve vergrößern und so die Belichtungsunterschiede in größere Dichteunterschiede umsetzen. Die entsprechende Entwicklung ist im Falle des Auseinanderzerrens von 4 Blenden auf 5 eine N+1-Entwicklung. Auch hier ändert sich die Filmempfindlichkeit nur wenig, weil der Effekt der Entwicklungszeitänderung auf eine Stelle des Negativs von der Menge belichteten Silbers an ebendieser Stelle abhängt. Wo nicht viel ist, ändert sich auch nicht viel.
Damit kommen wir gleich zu einem verbreiteten Missverständnis: Viele Fotografen glauben, durch verlängerte Entwicklung die Filmempfindlichkeit steigern zu können. Vielleicht haben Sie ein schlechtes Gewissen, weil Sie wissen, dass bei Unterbelichtung die Schatten absaufen, und bei der Aufnahme von Tante Gertrude im Garten haben Sie neulich vielleicht doch nicht so genau auf das im Schatten liegende Gesicht gemessen, sondern bei der Integralmessung viel Himmel im Bild gehabt. Getreu dem Grundsatz "Viel hilft viel!" wird dann lieber etwas zu lang als etwas zu kurz entwickelt. Vergessen Sie's.
Sie erreichen so nur eines: Negative, die Sie nur mit viel Mühe vergrößern können, weil nämlich die Schatten kaum an Zeichnung gewonnen haben, aber die Lichter so dicht geworden sind, dass sie auch mit Nachbelichtungen und anderen Tricks kaum noch vernünftig zu Papier zu bringen sind. Schattenzeichnung ist nur auf eine Weise zu erzielen: durch richtige Belichtung. Nicht umsonst heißt es:
Belichte auf die Schatten und entwickle auf die Lichter.
Das ist die Zusammenfassung der beiden letzten Merksätze in einem Satz. Sie können bei einem harten Negativ in Grenzen durch eine weiche Papiergradation erreichen, dass der abgestufte Bereich größer wird,aber alle Tonwerte werden flauer wiedergegeben. Ein gutes Bild lebt aber von einer "knackigen" Wiedergabe, ganz besonders im Bereich der Schatten. Das liegt z.T. daran, dass das Auge kleine Unterschiede in den fast schwarzen Bereichen schlechter sieht als in den fast weißen.
Obige Weisheit etwas anders formuliert sollte vielleicht lauten:
Belichte im Zweifel lieber etwas zu reichlich,
und entwickle dann lieber etwas zu kurz.
Auf die Weise erhalten Sie Negative, die reichlich Schattenzeichnung haben und Lichter, die Sie nötigenfalls mittels härterer Gradation des Papiers "hochziehen" können. (Die Betonung liegt allerdings auf dem Wort "etwas".)
Stellen wir uns zwei typische Grenzfälle vor:
- greller Sonnenschein im Sommer und
- trübes, graues, diffuses "Licht" im Winter
Bei Sonnenschein ist es hell, die Schatten sind tief. Was machen Sie? Nach dem zuvor Gesagten belichten Sie trotz der gleißenden Helligkeit etwas reichlicher, entwickeln aber etwas knapper.
Bei der grauen Suppe ist scheinbar nicht viel Licht da, aber richtige Schatten gibt es auch kaum. Was tun? Sie belichten ein wenig knapper und entwickeln etwas länger.
So viel zur Intuition!
Pushen und Pullen
Es ist mir wichtig genug, dass ich es noch einmal wiederhole: Sie werden durch verlängerte Entwicklung nicht die Empfindlichkeit Ihres Films nennenswert erhöhen, und Sie werden sie durch verkürzte Entwicklung nicht nennenswert senken.
Der einzige Weg zu einer höheren Empfindlichkeit bei gegebenem Film ist die Nutzung eines anderen Entwicklers.
Die tatsächliche Filmempfindlichkeit hängt von der Kombination von Film und Entwickler ab. Nachfolgend habe ich ein paar Entwickler mit ihren Auswirkungen auf die Filmempfindlichkeit aufgelistet. Die Liste ist alles Andere als vollständig, sondern enthält lediglich ein paar markante Beispiele aus meiner Praxis. Die Aussagen zur Empfindlichkeit sind in Relation zur "mittleren" Empfindlichkeit der Filme zu verstehen, die Sie mit anderen Entwicklern erzielen. Wie Sie Ihre eigene persönliche, für Ihre Gegebenheiten angepasste Empfindlichkeit ermitteln, habe ich letzten Monat beschrieben.
|
Entwickler |
Wirkung auf Empfindlichkeit |
sonstige Effekte |
|
2-Bad-Entwickler (Stöckler-Typen, Emofin usw.) |
bis zu 1 Blende Gewinn |
scharf, hinsichtlich des Korns neutral, stark ausgleichend*) |
|
Champion Promicrol |
½ bis 1 Blende Gewinn |
scharf, ausgleichend*) |
|
Ilford Perceptol |
rund 1 Blende Verlust |
feines Korn |
|
LP-CUBE XS |
bis zu 1 Blende Verlust |
feines Korn, scharf |
|
LP-SUPERGRAIN |
bis zu 1 Blende Gewinn |
kantenscharf, ausgleichend*) |
|
Rodinal, hohe Konzentrationen |
keine besondere |
relativ grobes Korn, kantenscharf |
|
Rodinal, stark verdünnt |
leichte Erhöhung |
weniger ausgeprägter Effekt beim Korn, stärkere Kantenschärfe, ausgleichend*) |
|
SPUR HRX |
meist geringer Verlust |
sehr scharf, feines Korn |
|
SPUR SLD |
rund 1 Blende Gewinn |
kantenscharf, ausgleichend*) |
|
*) Erläuterungen zu Ausgleichsentwicklern s. weiter unten |
||
Damit zurück zur Überschrift "Pushen und Pullen":
"Puschen" ist ein regional gebräuchliches Wort für Pantoffeln.
"Pushen", vom englischen "to push" = "schieben, drücken, stoßen", bedeutet, dass Sie einen Film länger entwickeln als normal. Sie erreichen damit nach dem zuvor Gesagten:
- höheren Kontrast
- geringfügig bis gar nicht erhöhte echte Empfindlichkeit
- groberes Korn
- höheren Schleier
also eine schlechtere Negativqualität, wenn Sie's ins Extrem treiben. Warum man's doch manchmal tut? Wo wenig Licht ist, ist oft auch wenig Kontrast. In Funzellicht-Situationen kann man daher durch Pushen kontrastreichere Negative erzeugen. Dass dabei eventuell im Bild befindliche Lichtquellen so zulaufen, dass beim Vergrößern keine Zeichnung mehr hinzubekommen ist, ist ein dann in Kauf genommenes Übel.
Wenn Sie jetzt nicht auf die Schatten messen, sondern auf die Mitteltöne, können Sie beim Pushen tatsächlich am Belichtungsmesser eine erhöhte scheinbare Empfindlichkeit einstellen. Mittelgrau ist nämlich ein Grauwert, der durch verlängerte Entwicklung schon merklich an Dichte zulegt. Seien Sie sich nur bewusst, dass die Schatten dann zeichnungslos bleiben.
"Pullen" von engl. "to pull" = "ziehen" heißt, dass Sie den Film verfrüht aus dem Entwickler ziehen. Damit hindern Sie die Lichter daran, eine zu hohe Dichte aufzubauen. Sinn macht das aus meiner Sicht nur, wenn Sie es mit hohem Kontrast zu tun haben. Zur Anpassung der Filmempfindlichkeit ist die Wahl eines anderen Entwicklers (z. B. LP-CUBE XS oder Ilford Perceptol) sinnvoller. Pushen bewirkt
- geringeren Kontrast
- geringfügig bis gar nicht verminderte echte Empfindlichkeit
- feineres Korn
- etwas geringeren Schleier
Wieder können Sie von einer geringeren scheinbaren Empfindlichkeit ausgehen, wenn Sie auf Mitteltöne oder Lichter messen, aber auf Kosten des Kontrastes.
Ausgleichsentwickler
Ab und an in diesem Artikel war schon die Rede davon, dass ein Entwickler "ausgleichend" wirke. Solche Entwickler sind die optimalen Entwickler für Anfänger, die ihre ersten Schritte auf unbekanntem Terrain wagen. Sie liefern so etwas wie die "automatisch richtige Entwicklung". Mit einem Ausgleichsentwickler machen Sie in den meisten Fällen nicht viel falsch. Sie mögen zwar auch nicht immer die optimal angepassten Negative erzielen (werden ihnen aber oft recht nahe kommen), aber meist gut vergrößerbare. Die Ausgleichswirkung besteht darin, dass die Schatten bevorzugt entwickelt werden, die Lichter aber nicht ins Kraut schießen können. Bei einem Ausgleichsentwickler wirken sich leichte Schwankungen in der Verarbeitung nicht so stark aus wie bei Entwicklern, die nach Zonensystem-Manier "auf den Punkt" entwickeln. Der Effekt ist am stärksten bei den erwähnten 2-Bad-Entwicklern.
Belichtungsmessung
Abschließend noch ein paar Worte zur Belichtungsmessung: Ich habe im Zuge des Artikels häufiger davon gesprochen, dass Sie "auf die Schatten", "auf die Mitteltöne" oder "auf die Lichter" messen sollen. Gemeint ist damit, dass Sie durch Nahmessung oder mittels eines Spot-Belichtungsmessers selektiv jeweils die dunkelste oder hellste Stelle Ihres Motivs anmessen sollen, die noch durchgezeichnet, also nicht schwarz bzw. weiß, wiedergegeben werden soll, bzw. bei den Mitteltönen, dass Sie etwas anmessen, das im fertigen Bild mittelgrau erscheinen soll. Das verlangt ein bisschen Übung und wäre schon an sich ein Thema für einen ganzen Artikel. Aber belassen wir es hier bei der Aussage, dass Sie nur so eine Information über den Kontrastumfang des Motivs bekommen.
Als Lösung aller Probleme wird oft die Lichtmessung gepriesen. Sie ist es, und sie ist es auch nicht.
Sie ist es, weil sie wesentlich weniger fehleranfällig ist als eine Spotmessung. Sie werden damit meist vernünftige Negative erzielen. Sie ist es nicht, weil sie keine Aussagen zum Kontrast liefert. Ist er hoch, fressen bei Lichtmessung möglicherweise sowohl die Lichter als auch die Schatten aus, ist er niedrig, belichten Sie reichlicher als nötig, aber in beiden Fällen nicht völlig daneben.
Zusammenfassung
- Ohne grundlegendes Verständnis der Sensitometrie ist richtige Belichtung und Entwicklung Glücksache.
- Entwicklungszeit beeinflusst den Kontrast, nicht die Empfindlichkeit.
- Etwas zu wenig Kontrast ist weniger problematisch als zu viel.
- Der Entwickler beeinflusst die Empfindlichkeit.
- Die besten Bilder entstehen mit knapper, aber ausreichender Belichtung.
- Pushen und Pullen ändern nur die scheinbare Empfindlichkeit.
- Die optimale Entscheidung über Belichtung und Entwicklung können Sie nur auf der Basis von Spot- oder Selektivmessungen treffen.
Sind Sie empfindlich?
So ermitteln Sie Ihre persönliche Filmempfindlichkeit
Thomas Wollstein
Februar 2003
Jeder hat so seine Empfindlichkeiten. Das gilt für Sie und mich, und das gilt auch für unsere Filme. Oft genug sind die Nennempfindlichkeiten, die die Hersteller auf die Packungen drucken, ein bisschen hoch gegriffen, vielleicht, weil sich mit hohen Zahlen besser werben lässt. Aber selbst wenn der Hersteller seine Zahl nach bestem Wissen und Gewissen auf die Packung druckt, gibt es immer noch Toleranzen bei den Filmen und den Belichtungsmessern. Von der Fa. Minox weiß ich z. B., dass all jene Kameras die Fabrik-Endkontrolle passieren dürfen, deren Abweichung vom Sollwert ± 1/3 Blende nicht überschreitet. Nicht viel, sagen Sie? Nun, 1/3 nach oben bei der einen Kamera und 1/3 nach unten bei der nächsten macht zwischen den zwei Messwerten schon eine Abweichung von einer satten 2/3-Blende. Wenn Sie mehr als einen Belichtungsmesser haben, sollten Sie sich also einmal den Spaß machen, mit allen Ihren Messgeräten eine Graukarte oder eine andere einheitliche Fläche formatfüllend auszumessen. Dazu jetzt noch die Toleranz bei den Filmen, und schon ist eine Abweichung von einer ganzen Blende durchaus nicht unrealistisch.
Dann gibt es noch andere Gründe, Film-Empfindlichkeiten selbst zu messen: Bei allen Informationen über Film/Entwickler-Paarungen, die man im Internet findet, z. B. in der Massive Development Chart (www.digitaltruth.com) oder der Mahoosive Dev Chart (https://darkroom-solutions.com/cdc), kommt es doch immer wieder einmal vor, dass man gerne einen Film mit einem bestimmten Entwickler ausprobieren möchte, und niemand auf der ganzen Welt scheint eine Anfangsempfehlung liefern zu können. Dann sind Sie ganz auf sich gestellt. Ich werde Ihnen nachfolgend meine Vorgehensweise vorstellen, mit der ich mit etwas Zeit und nicht mehr als zwei Filmen bei solchen Paarungen auch bei völligem Fehlen von Startinformationen zu vernünftigen Werten komme.
Testbedingungen
Klären wir zunächst, unter welchen Bedingungen wir testen.
Wir benötigen für den Test:
Testmotiv
Eine Graukarte ist prima, aber eine gleichmäßig ausgeleuchtete neutralfarbige einheitlich gefärbte Fläche (Wand, Textil) tut's genauso gut.
Beleuchtung
Wichtig ist, dass das Testmotiv gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Das funktioniert i.Allg. ganz prima, wenn Sie im Freien unter dem bedecktem Nordhimmel oder im Raum an einem Nordfenster fotografieren. Günstiger ist i.d.R. allerdings Kunstlicht, z. B. ein Halogenscheinwerfer aus dem Baumarkt, denn das Tageslicht hat oft die unangenehme Eigenschaft, mit der Zeit zu variieren. Sie messen dann z. B. einen Lichtwert 10 auf Ihrer Graukarte, aber bis Sie die nötigen Einstellungen an Ihrer Kamera vorgenommen und das Foto belichtet haben, ist es 9 ½ oder 10 ½. Mit dem Auge merken Sie das nicht, da die Änderung nicht sprunghaft vonstatten geht. Es kann einem schon ganz schön auf den Nerv gehen, vor und nach jeder Aufnahme zu messen, um sicher zu sein, dass das Licht gleich geblieben ist. An vielen Tagen werden Sie überhaupt nicht testen können.
Andererseits hat das Licht des Halogenscheinwerfers eine andere spektrale Zusammensetzung als Tageslicht: Es ist deutlich roter. Die mit dem Halogenscheinwerfer bestimmten Werte werden wegen der spektralen Empfindlichkeit der Messzelle Ihres Belichtungsmessers und der Sensibilisierung des Films möglicherweise also nicht ganz stimmen. Viele Belichtungsmesser neigen dazu, bei rotem Licht zu hohe Messwerte zu liefern, während panchromatisch sensibilisierte Filme bei rotem Licht weniger empfindlich sind. Sie sind typischerweise bei Glühlampenlicht rund 1/3 Blende weniger empfindlich als bei Tageslicht.
Ziemlich genau wissen Sie's, wenn Sie einmal für einen panchromatischen Film Belichtungsreihen für Tageslicht und für Glühlampenlicht aufnehmen, den entwickelten Film densitometrisch vermessen und die Kurven übereinander legen. Ansonsten müssen Sie sich zwischen Teufel (zeitliche Schwankungen) und Beelzebub (Abweichungen im Spektrum) entscheiden.
Zur Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung: Viele Bücher werden behaupten, mindestens zwei Lichtquellen seien erforderlich, um gleichmäßig auszuleuchten. Glauben Sie mir: Es geht auch mit einer. Man braucht vielleicht ein bisschen mehr Probiererei, bis man die richtige Stellung gefunden hat, aber es geht. Es geht nicht, wenn die Abmessung der Lampe vergleichbar ist mit deren Abstand zum Testmotiv, aber bei einem Abstand, der wesentlich größer ist als die Lampengröße, geht es erfahrungsgemäß ganz gut. Dazu muss die Lampe natürlich lichtstark genug sein. Wenn eben möglich, kontrollieren Sie die Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung mit einem Spotmeter. Sonst sind Sie auf Augenmaß angewiesen. Je weniger die Nadel um den Mittelwert schwankt, während Sie in der Mitte und auf den Diagonalen messen, desto besser. Ich erziele regelmäßig bei meinen Tests Abweichungen von deutlich weniger als einem Skalenintervall meines Belichtungsmessers (1/3 Blende), geschätzt würde ich sagen weniger als ± 1/6 Blende. So genau müssen Sie in freier Natur erst einmal messen!
Belichtungsmesser
Verwenden Sie für den Test den Belichtungsmesser, den Sie später für die Aufnahmen verwenden wollen. Er ist Bestandteil der Kette, die die Empfindlichkeit des Films beeinflusst. Idealerweise ist es ein Spotmessgerät. Haben Sie keine Möglichkeit zur Spotmessung, sorgen Sie bitte dafür, dass Sie Ihr Testmotiv formatfüllend aufnehmen.
Kamera (und Objektiv)
Für viele Fotografen stellt sich nicht die Frage, welche Kamera sie nehmen sollen, denn sie haben nur eine. Haben Sie mehrere, empfehle ich Ihnen, diejenige zu benutzen, zu deren Verschluss Sie das meiste Vertrauen haben. Ich habe einmal durch einen Test herausgefunden, dass bei einem älteren Kameramodell aus meinem Besitz die 1/30- und die 1/60-Sekunde gleich lang waren. (Filmtests sind also immer auch Gerätetests!) Üblicherweise ist auf elektronisch gesteuerte Verschlüsse hinsichtlich der Präzision der Zeiten mehr Verlass als auf mechanisch gesteuerte, zumindest wenn diese schon länger nicht gewartet oder von Ihnen getestet wurden.
|
|
Anmerkung: |
Das Objektiv verdient noch ein paar Worte: Nur Festbrennweiten (oder in Grenzen Zooms mit konstanter Blende) eignen sich wirklich für einen solchen Test. Bei Zooms mit variabler Öffnung wissen Sie nie genau, welche Blende Sie nun gerade effektiv haben. Nutzen Sie am besten ein festbrennweitiges Normal- oder leichtes Teleobjektiv (z. B. 80 mm). Weitwinkelobjektive sind weniger geeignet, da der Lichtabfall zum Rand hin stärker ist.
Die Aufnahmen schießen Sie mit auf Unendlich fokussiertem Objektiv, denn die Blendenwerte gelten wegen der Auszugsverlängerung streng genommen nur dort. Vermeiden Sie es möglichst auch, bei größter Öffnung zu fotografieren. Schärfe ist hier nicht das Argument (Schließlich fokussieren wir nicht einmal.), sondern der Randlichtabfall. Er ist bei etwas geschlossener Blende geringer.
Bei den Belichtungszeiten sollten Sie innerhalb des Reziprozitätsbereichs des Films bleiben, d.h. Zeiten zwischen etwa ½ bis ¼ s bis 1/2000 s benutzen.
Es kann vorkommen, dass Sie nicht mit einer Blende die gesamte Belichtungsreihe belichten können. Nehmen wir z. B. an, dass Sie die Belichtungsreihe mit Bl. 8 durchführen möchten und Zone III liegt bei Bl. 8, 1/500 s, die 1/1000 s bietet Ihnen Ihre Kamera nicht an. Dann ist es empfehlenswert, zunächst Zone III noch einmal mit Bl. 22, 1/60 s aufzunehmen, dann Zone II mit Bl. 22, 1/125 s usw. Auf der Kurve sollten die beiden Werte für Zone III näherungsweise zusammenfallen. Tun sie's nicht, deutet das auf eine Abweichung bei der Kamera (Blende oder Verschlusszeit), aber Sie fragen sich hinterher nicht, warum die Schwärzungskurve Ihres Films eine so merkwürdige Form hat.
Wenn Sie eine Kamera mit einer Datenrückwand haben, die die Einbelichtung von Blende und Verschlusszeit erlaubt, ist das ein absoluter Luxus. Es erlaubt Ihnen hinterher eine leichtere und sicherere Zuordnung der Aufnahmen zu Zonen.
Notizbuch und Stift
Die benötigen Sie unbedingt. Sie müssen folgende Testdaten für jeden Test notieren:
- Belichtungsmesser,
- Kamera,
- Objektiv,
- Testmotiv,
- gemessener Lichtwert,
- Film,
- Testbelichtungen (z. B. "Zone = 0 bis 12 in ganzen Schritten"), vorzugsweise auch die Zeit/Blenden-Kombinationen (s. dazu weiter unten),
- evtl. verbockte Aufnahmen (wenn Sie z. B. vergessen haben, Zeit oder Blende umzustellen),
Anmerkung: (1) bis (4) und bei Kunstlicht oft auch (5) sind oft identisch. Notieren Sie sie trotzdem.
Nachdem wir nun die "Hardwarevoraussetzungen" geklärt hätten, schreiten wir zum eigentlichen Test.
Testaufnahmen fürs grobe Einschießen
Wenn Sie über die zu testende Film/Entwicklerkombination gar nichts wissen oder die Entwicklungszeit recht unsicher ist, wäre es Humbug, gleich einen ganzen Film zu verschießen. Für grobe Tests empfehle ich Ihnen, an Ihrem Belichtungsmesser die vom Hersteller angegebene Nennempfindlichkeit einzustellen und zunächst Filmstücke zu produzieren, auf denen je drei Aufnahmen sind, je eine bei
- Zone II, also gegenüber dem Messwert um drei Stufen unterbelichtet,
- Zone V, nach Messwert belichtet,
- Zone VIII, also gegenüber dem Messwert um drei Stufen überbelichtet.
Richtwerte für die Filmkalibrierung sind eigentlich die Zonen I und VIII. Ich empfehle Ihnen trotzdem (zunächst) Zone II als Testzone, da sie einerseits bei verlängerten Entwicklungszeiten nicht extrem wandert, andererseits aber auch dann noch im auswertbaren Bereich bleibt, wenn der Hersteller eine um eine Blende zu hohe Empfindlichkeit angibt. Zone I wäre in diesem Fall schon Zone 0 und nicht mehr auswertbar.
Fertigen Sie eine solche Belichtungsreihe an und praktizieren Sie den Filmstreifen im Wechselsack oder der Dunkelkammer aus der Kamera in den Entwicklungstank. Jetzt haben Sie das Problem, sich eine grobe Entwicklungszeit für den ersten Versuch auszudenken.
Erste Probeentwicklung
Im Trend müssen hochempfindliche Filme länger entwickelt werden als niedrigempfindliche, aber die Streuung zwischen Filmen derselben Empfindlichkeitsklasse ist bei vielen Entwicklern beachtlich. Suchen Sie sich also aus den zu einem Entwickler angegebenen Zeiten eine für einen Film heraus, der Ihrem Prüfling am ehesten entspricht, d.h., wenn Sie z. B. einen Ilford Delta 100 entwickeln möchten und für den Entwickler liegt eine Zeit für den Kodak T-max 100 vor, dann nehmen Sie die erst einmal. Kriterien für Verwandtschaft sind Nennempfindlichkeit und Kristallstruktur.
Entwickeln Sie den Film schon ab der ersten Probeentwicklung pedantisch genau so, wie Sie das später mit den "richtigen" Filmen tun wollen. Das Zauberwort heißt "Wiederholbarkeit". Es muss so sein, dass zwei Streifen, die Sie gleich belichten und entwickeln, auch gleich aussehen, sonst ist die ganze Testerei für die Katz. Wie man richtig entwickelt, habe ich im Artikel "Entwicklungshilfe" geschildert. Im Einzelnen sind folgende Parameter penibel genau einzuhalten:
- Vorwässerung, falls angewendet,
- Verarbeitungstemperatur,
- Bewegung,
- Stoppbad oder Zwischenwässerung,
- Fixage.
Zeit und Entwickler sparen Sie, wenn Sie nach dem ersten Streifen zunächst einmal visuell prüfen, wie der Film ausschaut:
- Ist er viel zu dünn, entwickeln Sie gleich noch so einen Streifen mit der doppelten Zeit.
- Ist er sehr dicht, entwickeln Sie gleich noch einen mit der halben Zeit.
Bei kleineren Abweichungen vom Sollwert verdoppeln oder halbieren Sie natürlich nicht, sondern verlängern oder verkürzen vielleicht um 10 bis 15%, später vielleicht noch weniger.
Sie können die Streifen auch ruhig mit einem Haartrockner malträtieren. Bei "echten" Negativen rate ich davon ab, aber hier macht ein bisschen Staub nicht viel aus. Vermeiden Sie es nur, heiß zu pusten, handwarm reicht. Versuchen Sie dann eine Auswertung, wie weiter unten im Artikel beschrieben. Am einfachsten ist es, wenn Sie einen zu lang und einen zu kurz entwickelten Streifen haben. Die gesuchte Zeit muss dann irgendwo dazwischen liegen. Tasten Sie sich heran. In aller Regel sollten Sie nach 4 bis 5 Streifen, die Sie übrigens alle in demselben Ansatz entwickeln können, wenn Sie schnell arbeiten, und die alle noch von demselben Film stammen können, eine ziemlich gute Idee haben, wie die "richtige" Zeit aussehen muss.
Dann wird es Zeit für den Test mit einer ganzen Belichtungsreihe.
Feinschliff
Wenn Sie sich durch Versuch und Irrtum langsam an die richtige Entwicklungszeit herangetastet haben, fertigen Sie eine Belichtungsreihe mit mindestens folgenden Aufnahmen an:
- Zone -I bis III.
- Zone V,
- Zone VIII bis X.
Die fehlenden Zonen können Sie ruhig auch mit aufnehmen, aber sie sind nicht wirklich nötig. Im günstigsten Fall haben Sie also wieder nur Schnippsel mit 10 Aufnahmen, von denen ein Film bis zu drei hergibt.
Entwickeln Sie diesen Streifen in frisch angesetztem Entwickler wieder pedantisch genau nach Ihrer Methode (s.o.). Die Auswertung wird unterschiedlich sein, je nachdem ob Sie ein Densitometer oder Vergrößerungen verwenden.
Auswertung
Densitometrische Messungen
Wer ein Densitometer besitzt, und sei es ein noch so einfaches, hat es leicht: Die Auswertung geschieht durch bloßes Ausmessen der Negativdichten und Auftragen der Dichte als Funktion der Belichtung. Das liefert die so genannte Schwärzungskurve der Film/Entwickler-Kombination. Für die so genannten N- (Normal-), N-minus- (kontrastabschwächenden) und N-plus- (kontrastverstärkenden) Entwicklungen gibt es Referenzwerte bzw. -kurven aus der Literatur. Sie unterscheiden sich ein wenig, je nachdem, ob Sie einen Kondensor- oder Diffusorvergrößerer nutzen, gelten also vielleicht nicht zu 100% für Ihre Geräte und Ihr Papier, sind aber gute Anhaltswerte. Wenn Sie andere Erfahrungswerte haben, können Sie natürlich auch die nehmen.
Zwei Dinge gilt es zu unterscheiden:
- Filmempfindlichkeit und
- Kontrast.
Über die Entwicklungszeit passen Sie im Wesentlichen den Kontrast an, d.h. die Steigung der Kurve. Die Empfindlichkeit des Films lässt sich über verlängerte Entwicklungszeit nicht wesentlich erhöhen.
Liegt Ihre gemessene Kurve also insgesamt unter (bzw. über) der Referenzkurve, hat aber eine ähnliche Steigung (ist also ungefähr parallel), so ist die Entwicklungszeit schon ganz gut, aber der Film hat nicht die von Ihnen angesetzte Empfindlichkeit. Sie können dann Ihre Kurve und die Referenzkurve näherungsweise zur Deckung bringen, indem Sie Ihre Kurve nach links (bzw. rechts) verschieben. Für jede Stufe, die Sie Ihre Kurve nach links (rechts) verschieben, bis sie sich mit der Referenzkurve deckt, müssen Sie die Empfindlichkeit halbieren (verdoppeln).
Liegen dagegen die unteren Messwerte (bei Grobmessung Zone II, sonst Zone I) in etwa auf derselben Höhe wie die der Referenzkurve, so stimmt die Empfindlichkeit. Jetzt gilt es noch den Kontrast über die Entwicklungszeit anzupassen.
Wiederholen Sie - mit angepasster Empfindlichkeitseinstellung und Entwicklungszeit - den Vorgang
- Belichten eines Teststreifens
- Entwickeln
- Auswerten
bis die Kurve des Films hinreichend nahe bei den Referenzwerten liegt. Dabei sind leichte Abweichungen in bestimmten Kurvenabschnitten nicht so entscheidend. Als Eckwerte für richtige Entwicklung werden die Dichten bei den Zonen I und VIII betrachtet. Diese sollten also möglichst genau auf der Referenzkurve liegen.
Auswertung durch Vergrößern
Diese Art der Auswertung ist etwas langwieriger als die densitometrische, hat aber den Vorzug, auch Ihren Vergrößerer und Ihr Fotopapier in die Kalibrierung mit einzubeziehen.
Im Einzelnen verfahren Sie wie folgt:
(1) Vergrößern Sie das der Zone II entsprechende Negativ so auf ein Stück Fotopapier mittlerer Gradation (Spezial, Normal oder Gradation 2 bis 2 ½), dass es eben gerade vom tiefsten Schwarz des Papiers unterscheidbar ist, sozusagen eben "unschwarz". (Im Englischen gibt es dafür das schöne Wort "off-black".)
Hat das Negativ keine erkennbare Dichte oder gelingt es Ihnen nicht, eine evtl. mit bloßem Auge im Negativ erkennbare Dichte "unschwarz" aufs Papier zu bringen, hat der Film nicht die angesetzte Empfindlichkeit. Wiederholen Sie die Reihe mit halbierter Empfindlichkeitseinstellung.
(2) Vergrößern Sie nun bei unveränderter Einstellung des Vergrößerers und mit derselben Belichtungszeit und Blende das Negativ der Zone VIII. Es sollte "unweiß" (off-white) sein. Ist es völlig weiß, müssen Sie im nächsten Schritt kürzer entwickeln, ist es schon deutlich grau, entwickeln Sie länger.
So selbstverständlich es eigentlich ist, wiederhole ich auch hier noch einmal, dass die Verarbeitung des Fotopapiers wie die der Filme reproduzierbar erfolgen muss, d.h. penibel standardisiert. Später, bei einzelnen Fotos, können Sie sich Abweichungen erlauben, da diese nur jeweils ein Bild betreffen, aber beim Testen müssen Sie genau arbeiten, um ein genaues Ergebnis zu bekommen. Eine Unsicherheit im Testergebnis schlägt durch auf alle Fotos, die unter Zugrundelegung dieses Ergebnisses aufgenommen werden.
Sollwerte
Zur Übersicht habe ich Ihnen die Eckwerte in einer Tabelle zusammengestellt.
|
Zone |
Positiv-Grauwert bei mittlerer Gradation |
ungefähre log. Dichte |
|
I |
(bei Kalibration ohne Densitometer nicht empfohlen) |
0,1 |
|
II |
erstes von Schwarz unterscheidbares Grau |
0,2 |
|
V |
18% Grau |
0,7 |
|
VIII |
von Papierweiß gut unterscheidbares Weiß |
1,3 |
Beispiel
Nachfolgend ein Beispiel für eine Testreihe, die ich unlängst durchgeführt habe. Eingetestet habe ich den MACO CUBE 400c mit einem Entwicklerprototyp, für den es noch keine Orientierungswerte gab.
Entsprechend dem Vorschlag oben habe ich zunächst drei Streifen mit den Zonen II, V und VIII belichtet und den ersten Streifen mit 8 Minuten entwickelt. Visuell sah er etwas zu dünn aus, und der zweite und dritte mussten 10 und 15 Minuten baden. Es war spät am Abend, und ich wurde mit der Zeit nicht frischer, daher habe ich beim dritten Streifen die Vorwässerung, die MACO für den CUBE 400c empfiehlt, vergessen. Immerhin war ich aber noch so wach, dass ich es gemerkt und für später notiert habe, bevor ich für den Tag die Duka dicht machte.
Am nächsten Tag habe ich dann die Streifen densitometrisch ausgewertet. Wie erwartet war der 8 Minuten entwickelte Streifen unterentwickelt, der mit 15 Minuten überentwickelt. Der Streifen, der 10 Minuten in Miraculix' Zaubertrank gefallen war, war auch noch zu dünn. Aber damit fühlte ich mich sicher genug, eine volle Belichtungsreihe durchzuführen. Diese habe ich dann mit Vorwässerung für 12 ½ Minuten entwickelt, und siehe da: die Dichtewerte lagen dort, wo ich sie haben wollte.
Die vier Kurven sind im Bild dargestellt.
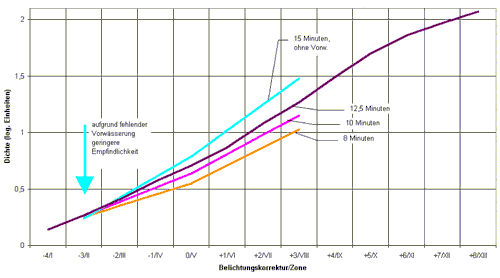
Müdigkeit kann auch ihr Gutes haben: Ich wollte schon immer einmal ausprobiert haben, ob die Vorwässerung neben der ihr zugeschriebenen gleichmäßigeren Entwicklung bei kurzen Zeiten noch andere Auswirkungen hat, z. B. - wie von MACO behauptet - eine bessere Empfindlichkeitsausnutzung. Mein Versehen lieferte mir die Messwerte dazu: Der Vergleich der Kurven zeigt deutlich, dass der nicht vorgewässerte Film in Zone II eine geringere Dichte hat als die anderen, obwohl er länger entwickelt wurde. Bei den drei anderen Streifen nehmen die Dichten von Zone II erwartungsgemäß von Kurve zu Kurve um rund 0,01 zu. Der Streifen mit 15 Minuten hätte also eine Dichte von rund 0,27 haben müssen, hatte aber nur rund 0,24. Man darf also davon ausgehen, dass die Vorwässerung tatsächlich die Empfindlichkeitsausnutzung verbessert.
Im nächsten Bild sind die Referenzwerte für N-, N-1- und N+1-Kurven für die Nennempfindlichkeit im Vergleich aufgetragen.
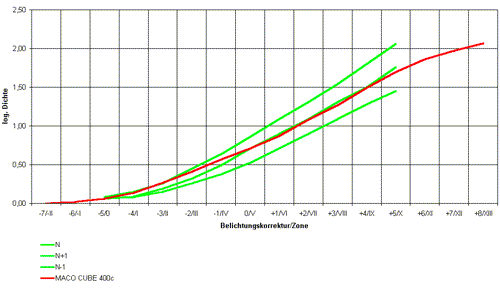
Man sieht, dass der Film in diesem Entwickler eine etwa um eine halbe Blende höhere Empfindlichkeit aufweist als von MACO angegeben, denn wenn man die Kurve um etwa eine halbe Zone nach rechts schieben würde, läge sie im Schattenbereich ziemlich genau deckungsgleich mit der Sollkurve für N-Entwicklung, im Lichterbereich etwas darunter, was sich durch eine geringfügige Verlängerung der Entwicklungszeit auch noch anpassen ließe. Für meine Anwendungen würde ich allerdings die Empfindlichkeit mit ISO 400/27° ansetzen und die ermittelte Entwicklungszeit so nutzen, dass ich die erhöhte Schattendichte gut gebrauchen kann und sie nicht mit zugelaufenen Lichtern bezahlen muss.
Der MACO CUBE 400c hat eine erweiterte Rotempfindlichkeit. Daher kann man nicht einfach davon ausgehen, dass er sich bei Tageslicht und Glühlampenlicht gleich verhält. Als letztes interessantes Ergebnis möchte ich Ihnen daher noch den Vergleich der Belichtungsreihen für Tageslicht und Kunstlicht zeigen.
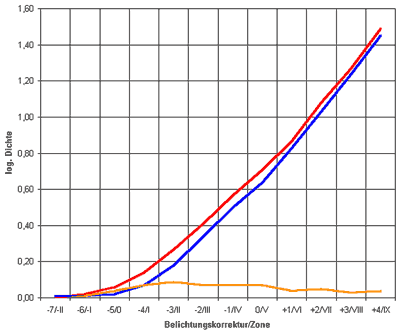
Die drei Kurven
- Rot: Halogenlicht
- Blau: diffuses Tageslicht
- Orange: Dichtedifferenz bei angenommener gleicher Empfindlichkeit
zeigen, dass dieser Film bei Glühlampenlicht (Das ist nicht dasselbe wie Kunstlicht allgemeiner Art!) um fast eine Blende empfindlicher ist als bei Tageslicht.
ABER: Diese Werte gelten zunächst nur für meinen Belichtungsmesser! Ihr Belichtungsmesser hat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine andere spektrale Empfindlichkeitsverteilung und kann möglicherweise bei rötlicherem Licht zu hohe oder zu niedrige Werte anzeigen. Sie sollten also ohne Test nicht davon ausgehen, dass der MACO CUBE 400c auch bei Ihnen automatisch bei Glühlicht um eine Blende schneller ist.
Thomas Wollstein
Januar 2003
Jahreswenden sind naturgemäß ein beliebter Anlass für Nabelschauen, Rückblicke und Blicke in die Kristallkugel. Nachdem mein erster "untechnischer" Beitrag Sie, liebe Leser, nicht davon abgehalten hat, meine Kolumne weiter zu lesen, riskiere ich es, einen weiteren Beitrag zu veröffentlichen, der teils Untechnisches enthält, aber auch Nachträge zu vergangenen Artikeln, wo ich im Laufe der Zeit Neues gelernt habe. Fangen wir daher an mit der
Nabelschau
"Worüber soll ich denn schreiben?" Das war vor rund zwei Jahren meine Frage an Herrn Löffler, als er mich ansprach und mich bat, diese Kolumne zu schreiben. Die Antwort war einfach - für Herrn Löffler: "Was Sie wollen." Damit hatte ich das Problem, mir geeignete Themen zu überlegen, und ein Problem war es:
- Ein meinungsmachender Kolumnist, der über Aktuelles motzt (Anspielung gewollt), bin ich im Normalfall nicht.
- Leser um Bildeinsendungen bitten, um diese dann zu zerpflücken, das ist auch nicht so mein Ding. Um die Werke anderer zu verreißen, müsste ich sicher sein, dass ich es besser könnte. Sorry, diese Selbstsicherheit fehlt mir.
Meine Phantasie reichte daher nur aus, mir zunächst "Technik" auf die Fahne zu schreiben. Das tat ich denn, und Rückmeldungen von "Wie können Sie nur?" (Gott sei Dank nur sehr wenige) bis "Super!" (erfreulich viele) lassen mich glauben, dass die Kolumne nicht schlecht angekommen ist. Ich will also versuchen, weiterzumachen. Nicht immer habe ich es geschafft, hochinteressante und tiefschürfende Artikel zu schreiben, schließlich ist diese Kolumne ein unbezahlter Job, d.h. ich muss für meinen Lebensunterhalt arbeiten und habe nicht immer gleich viel Zeit.
Mittlerweile (muss ein Alterseffekt sein) habe ich ab und an doch Lust, auch einmal "untechnisch" zu werden und zum Kommentator zu werden. Damit müssen Sie, liebe Leser, leben. Wenn's Ihnen mal gar nicht passt, schreiben Sie mir eben eine
Genug der Nabelschau. Wenden wir uns dem
Rückblick
auf das vergangene Jahr zu, diesmal bezogen auf die Entwicklung im Bereich unseres Hobbys.
Im Jahr 2002 hat es nur wenig Neues aus dem Bereich der klassischen Fotografie zu vermelden gegeben. Die photokina im September zeigte überdeutlich den Trend zur Digitalfotografie, wie er sich in Zeitschriften und anderen Veröffentlichungen schon lange zeigt. Dass es so kommen musste, war schon lange klar: Der Hauptmarkt für die großen Firmen ist der "Consumer"-Markt, der Markt der kleinen, möglichst schicken Knipskästen, mit denen man Statuspunkte erntet und möglichst ohne jegliches Denken schöne - bunte - Bildchen machen kann.
Wer will denn schon eine schwere Ausrüstung aus kompliziertem technischem Gerät mit sich herumschleppen und sich dann auch noch in einem dunklen Raum einsperren und Stunden mit stinkenden, ungesunden Chemikalien verbringen, nur um Bilder zu bekommen? Der Markt dieser Masochisten ist so klein, dass immer mehr der zugehörigen Produkte eingestellt werden.
Sicher, es gibt noch ein paar große Firmen und ein paar kleine Nischenanbieter, die nach wie vor SW-Filme, -Papiere und -Chemie in hoher Qualität anbieten, und - dafür müssen wir wirklich dankbar sein - es gibt sogar noch ganz selten ein paar Neuerungen auf diesem Gebiet.
Die tollsten Neuerungen auf dem Gebiet der SW-Fotografie in dem Zeitraum, über den sich meine Kolumne erstreckt, sind für mich folgende (Reihenfolge alphabetisch):
• EPSON-Drucker mit hoch lichtbeständigen Tinten,
endlich ist die Arbeit, die man am Rechner in ein Bild steckt, nicht nach 6 bis 12 Monaten zum Teufel. Drucke des EPSON 2100 sind bis zu 75 Jahre lichtbeständig, und die Qualität der Ausdrucke braucht den Vergleich mit konventionell erzeugten Fotos nicht mehr zu scheuen. Inzwischen ist der bei den ersten Druckern dieser Art auftretende Metamerismus kein Problem mehr, und genau wie die ersten kontrastvariablen Papiere - denen man auch nachsagte, dass sie für ernsthafte Fotografen zu schlecht seien - haben die Papier/Tinte-Kombinationen inzwischen so weit aufgeholt, dass die Maximaldichte von Digitaldrucken heute schon so hoch ist, dass eine Menge silberbasierte SW-Papiere sie nicht erreichen.
• Digitalkameras mit vollformatigem (KB-großem) CCD-Array,
bei denen mein geliebtes 28er-Shift-Weitwinkel nicht zu einem Shift-Normalobjektiv degradiert. Leider sind die ersten Modelle (m.W. zuerst von Contax auf den Markt gebracht, jetzt von Kodak aufgegriffen) noch recht teuer (rund EUR 7000).
• MACO CUBE 400 c,
ein einzigartiger Film hinsichtlich Emulsionsstruktur (drei Schichten), Träger (PE, archivfest) und Sensibilisierung (erweiterte Rotempfindlichkeit).
• MACO IR-Filme, besonders MACO IR 820c,
endlich Konkurrenz für Kodak, und noch dazu feineres Korn.
• MACO PO 100c,
der einzige Film mit orthopanchromatischer Emulsion und extrem hoher Auflösung für einen Film dieser Empfindlichkeitsklasse.
• MACO TP 64c,
MACOs Konkurrenzprodukt zum Kodak Technical Pan und Agfa Copex Rapid. Ob der Anspruch stimmt, kann ich derzeit noch nicht sagen, da ich bisher nur mit LP-Chemie testen konnte. Damit ist es ein Film mit ultrafeinem Korn und weicher Gradation. Ich hoffe, in nicht zu ferner Zeit auch mit SPUR testen zu können.
• SPUR HRX Entwickler,
der zusammen mit z.B. Ilford Delta 100 Negative ergibt, die schon an Mittelformatqualität erinnern.
• SPUR Nanospeed Entwickler zusammen mit Agfa Copex Rapid,
eine Filmkombination, die hinsichtlich Auflösung kaum zu schlagen ist und die erheblich nutzerfreundlicher ist als der Hauptkonkurrent Kodak Technical Pan.
• SPUR SLD Entwickler,
der Speed Limit Developer, der aus hochempfindlichen Filmen das Optimum an Empfindlichkeit herausholt und dabei scharfe Negative mit angenehmer Gradation liefert.
Was habe ich dazugelernt?
Gehen wir die Artikel chronologisch durch:
11/2000, Kornscharfsteller:
Das Problem dürfte unverändert der Anlass für manches graue Haar sein, da man nicht gleich drauf kommt, in dieser Richtung zu suchen. Geändert hat sich nichts.
12/2000, Schnelle Zweibadfixage und kurze Wässerung:
Ich rede mir immer noch den Mund fusselig, um allen die Verdienste der Zweibadfixage nahe zu bringen (siehe auch 07-08/2001 und 10/2001). Einbadfixage kann - das liegt in Naturgesetzen begründet - allerhöchstens bei ganz geringer Ausnutzung der Bäder richtig ausfixierte Bilder liefern.
Zur kurzen Wässerung möchte ich zwei Dinge nachtragen:
- Ich hatte im Laufe der Zeit ein paar Mal den Eindruck, dass Soda als Wässerungshilfe für einen nach dem Trocknen sichtbar werdenden milchig-grauen Belag verantwortlich war, wenn Bilder in Selentoner behandelt wurden und das Waschwasser relativ hart war. Wer also häufig mit Selentoner tont, dem sei statt 1%iger Sodalösung 2%ige Natriumsulfitlösung ans Herz gelegt. Sie ist sogar noch wirksamer als Sodalösung, da die Sulfitionen Thiosulfationen durch Ionenaustausch aus dem Bild verdrängen.
- Die Anwendung einer Wässerungshilfe wird eminent wichtig, wenn die Waschtemperatur niedrig ist, z.B. bei kälterem Leitungswasser im Winter. Sie macht den Effekt der Temperatur mehr als wett.
01/2001, Haltbarkeit von PE- und Barytpapier:
Da gibt es keine neuen Erkenntnisse. Für Agfas Sistan wird seit einiger Zeit beim IPI, dem Image Permanence Institute, einer neutralen Institution, ein Test der Wirksamkeit durchgeführt.
02/2001, Blendenschritte bei Probestreifen:
Ich bleibe dabei!
03/2001, Archivfeste Tonungen:
Keine neuen Erkenntnisse, außer zu Agfa Sistan, siehe 01/2001.
04/2001, Negativ-Vorbelichtung:
Sollte man unbedingt einmal ausprobieren, spätestens, wenn der Motivkontrast mehr als 10 Blendenstufen beträgt.
05/2001, Schärfentiefe-Optimierung:
Auch das gilt unverändert: Nutzen Sie optische Gesetzmäßigkeiten und vertrauen Sie nicht blind der auf Ihr Objektiv gedruckten Schärfentiefenskala, zumal, wenn Sie gar nicht wissen, welche Kriterien (Streukreisdurchmesser) ihr zugrunde liegen.
06/2001, Flecken auf Negativen und Bildern vermeiden:
Nichts Neues. Die Salatschleuder hat viele neue Anhänger gefunden.
07-08/2001, Fixieren:
Sagen wir es noch einmal: Wer seine Fotos liebt, fixiert in zwei Bädern. Alles andere ist Humbug.
09/2001, Licht in der Duka:
Nichts Neues.
10/2001, Negativverarbeitung:
Auch "alte Hasen" machen viel falsch.
11/2001, Lith-Printing:
Immer mehr mein Lieblingsverfahren. Probieren Sie's, aber ich übernehme keine Haftung für die immanente Suchtgefahr.
12/2001, 01/2002, und 06/2002, Infrarot-Fotografie:
Auch etwas, das man unbedingt probieren sollte. Und zusammen mit Lith-Printing einfach unschlagbar!
03/2002, Passepartouts schneiden:
Bilder brauchen eine gemäße Umgebung. Passepartouts selber zu schneiden ist einfacher als Sie vielleicht gedacht haben.
04/2002, Ausrichtung des Vergrößerers:
Ein oft unterschätztes und vernachlässigtes Problem.
Nachzutragen wäre hier vielleicht, dass es natürlich auch die Methode gibt, den Vergrößerer mittels eines Spiegels in der Negativebene auszurichten. Das Verfahren ist sicher genauer als das von mir im Artikel beschriebene, aber auch nicht ganz einfach. Versalab bietet ein Laser-Ausrichtungsgerät an, das nach diesem Verfahren funktioniert und nicht ganz billig ist.
05/2002, Analog oder digital?
Die Antwort ist für mich einfach: Beides!
07-08/2002, "Zonensystem" für Papier:
Nichts nachzutragen.
09/2002, Stativ:
Hier ist vielleicht gerade die Tatsache nachzutragen, dass mir keine neuen Erkenntnisse vorliegen. Ich hatte im Nachgang zu diesem Artikel eine technische Anfrage an mehrere Stativhersteller (Berlebach, Gitzo, Manfrotto, Velbon) gerichtet, aber nicht einer sah sich in der Lage, sie zu beantworten. Kundenfreundlichkeit in höchster Form!
10/2002, persönliche An- und Einsichten:
Die sind naturgemäß wandelbar, aber nicht ganz so schnell.
11/2002, meine besten Film/Entwickler-Kombinationen:
Noch ziemlich kurz zurück liegend, daher nichts Neues.
12/2002, Ansatz von Fotochemie:
Nun ja. So etwas Grundlegendes ändert sich nicht.
01/2003, dieser Artikel:
Ich hoffe, Sie fanden ihn lesenswert und hoffe, dass ich Ihnen auch in Zukunft noch Interessantes bieten kann. Wie eingangs erwähnt, werde ich ab und zu auch einmal wieder untechnisch werden und einfach meinen Senf zu bestimmten Dingen abgeben, und wer Hilfe bei technischen Problemen sucht, gleich ob er Anfänger oder Fortgeschrittener ist, oder wer gerne einmal ein Bild zerpflückt haben möchte, mag mich auch ansprechen, aber im Trend wird dies sicher eine technische Kolumne bleiben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nach hoffentlich erholsam verbrachten Feiertagen einen guten Start ins neue Jahr und für 2003 alles Gute.
Wasser ist (nicht nur) zum Waschen da!
Thomas Wollstein
Dezember 2002
Man nehme...
Die Hauptzutat fotografischer Lösungen ist - richtig:
Wasser
In den meisten Fällen reicht normales Leitungswasser, Trinkwasser, aus, da dieses in Deutschland von recht hoher, gesetzlich geregelter Qualität ist. Aber: auch Stoffe, die im Trinkwasser zugelassen sind, weil sie gesundheitlich unbedenklich sind, z.B. Kalzium- und Magnesiumsalze, können die im Zuge der Verarbeitung ablaufenden chemischen Reaktionen beeinflussen. Die Hersteller fotografischer Lösungen versuchen durch Hilfsstoffe z.B. die Wasserhärte - eben jene Kalzium- und Magnesiumsalze - zu maskieren, so dass sie die Verarbeitung nicht stören. So lange die Zusammensetzung des Wassers konstant ist, ist auch die durch Beimengungen verursachte Beeinflussung konstant und stört nicht, wenn man seine Verarbeitung selbst kalibriert hat. Störend sind Prozessschwankungen durch Änderungen der Wasserqualität, weil man bei der Aufnahme dann nie weiß, was bei der Verarbeitung mit dem Bild passieren wird.
Folgende Empfehlungen sollte man beherzigen, wenn man auf der sicheren Seite liegen möchte:
- Leitungswasser für Fixierbäder
- Schwebstofffreies Wasser für die meisten alkalischen Entwickler und Abschwächerlösungen
- Demineralisiertes Wasser für Feinkornentwickler und Verstärkerlösungen sowie auf jeden Fall für Toner
Wenn das vorhandene Leitungswasser extrem hart ist (Auskunft dazu können die lokalen Wasserwerke geben.) und demineralisiertes Wasser nicht verfügbar ist, kann man sich helfen, indem man Leitungswasser für 20 Minuten kochen lässt. Das fällt praktisch die gesamte Wasserhärte in Form unlöslicher Niederschläge aus und treibt alle gelösten Gase aus.
Filtern nach dem Abkühlen entfernt die ausgefällten Niederschläge. (Man sollte allerdings nur im Notfall zu dieser Lösung greifen, da die Kocherei ziemlich viel Energie verschlingt und das so gereinigte Wasser teuer und wenig umweltfreundlich macht. Lange dauern tut´s auch: 20 min Kochen plus ein Vielfaches davon, bis das Wasser so kühl ist, dass man es zum Ansatz verwenden kann.)
Konzentration ist alles
Die Stärke einer Lösung ist ihre Konzentration oder auch Verdünnung. Am verbreitetsten sind
Konzentrationsangaben in Teilen
Beispiele sind etwa Entwicklerverdünnungen wie 1+4 oder 1:4. Dabei sind die beiden Angaben nicht gleichwertig:
1+4 bedeutet, dass sich die Gesamtmenge aus 5 Teilen zusammensetzt, nämlich 1 Teil Konzentrat plus 4 Teile Wasser.
1:4 bedeutet, dass die Gesamtmenge aus 4 Teilen besteht, von denen 1 Teil Konzentrat ist.
Man sieht schnell, dass die beiden Angaben umrechenbar sind: 1+4 ist gleichwertig mit 1:5.
Bei großen Gesamtmengen, z.B. einem Ansatz von 1+100, ist der Unterschied natürlich marginal.
Konzentrationen in Prozent
Wenn die Rede ist von einer 2%igen Natriumsulfitlösung (z.B. als bewährte Wässerungshilfe), ist die Frage, "2% von was?". Solche Lösungen sind ein typisches Beispiel für den Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Gemeint ist nämlich: Man nehme 20 g (also eine bestimmte Masse) Natriumsulfit, löse diese in Wasser auf, das man dann auf 1 l (also ein bestimmtes Volumen) auffüllt. Die Angabe sind also "Prozent Gewicht je Endvolumen" (engl.: % w/v für weight/volume).
Entsprechend ist es überraschenderweise möglich, mehr als 100%ige Lösungen zu erzeugen, wenn die gelöste Substanz sehr gut löslich ist. Man kann z.B. eine 100%ige Natriumthiosulfatlösung bereiten, indem man 100 g Natriumthiosulfat in Wasser auflöst und auf 100 ml verdünnt.
Wenn man von einer vorhandenen konzentrierten Lösung ausgeht, die verdünnt werden soll, ist es gebräuchlich, Volumenprozent (engl.: % v/v für volume/volume) als Konzentrationsangabe zu benutzen: Für eine 10%ige Lösung einer Flüssigkeit A nehme man 10 ml von A und verdünne auf 100 ml Lösung.
Beispiel: Eine 2%ige Essigsäure bekomme ich, wenn ich 2 ml Eisessig (konz. Essigsäure) auf 100 ml Lösung auffülle. (Tatsächlich enthält Eisessig aber rund ein halbes Prozent Wasser, so dass die Lösung nicht genau 2%ig ist, aber für alle praktischen Zwecke ist die Angabe genau genug.)
Die Krise bekommen viele Laboranten, wenn von ihnen z.B. verlangt wird, aus 28%iger Essigsäure (die viel weniger gefährlich in der Handhabung ist als Eisessig), eine 10%ige Lösung anzusetzen. Hier hilft die
Kreuzmischregel
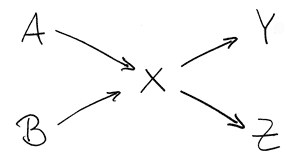
Dabei ist:
A die prozentuale Konzentration der zu verdünnenden Lösung
B prozentuale Konzentration der zum Verdünnen verwendeten Lösung (bei Wasser B = 0)
X prozentuale Konzentration der gewünschten Lösung
Y = X-B das zu verwendende Volumen der zu verdünnenden Lösung
Z = A-X das zu verwendende Volumen des "Verdünnungsmittels"
Klartext: Y ml Lösung der prozentualen Konzentration A plus Z ml Lösung der prozentualen Stärke B ergeben eine Lösung der gewünschten prozentualen Konzentration X.
Beispiel: Die genannte 28%ige Essigsäure soll mit Wasser auf 10% verdünnt werden.
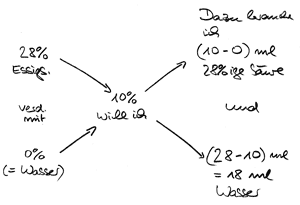
Also geben 10 ml 28%iger Essigsäure plus 18 ml Wasser eine 10%ige Essigsäure.
Wasser und Säure - da wird es bei einigen klingeln. Da war doch dieser Spruch im Chemieunterricht:
"Gießt du Wasser auf die Säure, dann geschieht das Ungeheure!"
Der Reim klingt harmloser als er ist: Bei der Mischung von Wasser und Säure wird durch eine chemische Reaktion Energie frei, die dazu führt, dass sich die Mischung erwärmt. Ist die Säure sehr konzentriert und kommt nur wenig Wasser dazu, so wird auf engem Raum sehr schnell sehr viel Energie frei gesetzt. Die Folge ist, dass sich an dieser Stelle die Mischung plötzlich so weit erhitzt, dass das Wasser schlagartig verdampfen kann. Dann spritzt es möglicherweise, und was da spritzt ist nicht nur Wasser, sondern auch die konzentrierte Säure.
Die Situation ist entschärft, wenn man Säure auf Wasser gießt. Warum? Es ist viel Wasser da, in dem sich die Säuremoleküle und die entstehende Wärme gut verteilen können. Man gießt also ein wenig Säure langsam in viel Wasser. Dann passiert nichts Schlimmes.
Der Spruch gilt übrigens in gleicher Weise für starke Basen: Auch bei der Zugabe von Wasser z.B. zu Natriumhydroxid kann es zu explosionsartigem Sieden des Wassers kommen. Verlust des Augenlichts und Verätzungen (teilweise mit bleibenden Vernarbungen) können die Folgen solcher Achtlosigkeit sein.
Das Thema
Sicherheit im privaten Umfeld
ist überhaupt ein trauriges. Im beruflichen Umfeld ist durch arbeitsrechtliche Vorschriften in aller Regel gut für die Sicherheit von Arbeitnehmern gesorgt, doch daheim sieht es anders aus: Nicht nur, dass es keinen Sicherheitsingenieur gibt, der auf die Einhaltung der Sicherheitsvorgaben achtet. Zu allem Überfluss sind es oft auch noch unzureichend ausgebildete Leute, die mit den gefährlichsten Substanzen hantieren. Der am Arbeitsplatz durch Vorschriften und ggf. Aufpasser gut beschützte Chemielaborant hat im Rahmen seiner Ausbildung gelernt, mit Gefahrstoffen umzugehen, der nicht geschulte "Künstler" in der Dunkelkammer aber nicht. So wundert es nicht, dass daheim viele, teilweise fatale, Unfälle passieren.
Um das Ganze abzurunden, finden es viele Leute auch noch ausgesprochen "cool", sich wissentlich Gefahren auszusetzen. Sind doch alles Memmen, die beim Hantieren mit Chemikalien Handschuhe und Schutzbrille tragen oder ihre Finger nicht in den Entwickler, möglichst Pyro, tauchen wollen. Wer derart spätpubertär anmutende Äußerungen von sich gibt, kann mir nur leid tun.
Wenn Sie nicht wissen, welche Gefahren ein Stoff birgt,
behandeln Sie ihn in Ihrem eigenen Interesse mit Respekt!
Zwar werden die Bilder der meisten Künstler erst nach dem Tod der Künstler richtig wertvoll, aber die Künstler haben dann nichts mehr davon, und die Nachkommen hätten vielleicht auch mehr von Vater oder Mutter als vom Geld für deren Bilder.
(Nachtrag: Meine Frau meint, ich solle Ihnen nicht gleich Ihr baldiges Ableben in Aussicht stellen. So dramatisch sei es doch vielleicht nicht. Sie hat Recht: Sie werden nicht morgen sterben, wenn Sie heute Ihre Finger Hydrochinon oder Pyrogallol enthaltende Entwickler tauchen. Allerdings steigen Ihre Chancen auf gesundheitliche Spätfolgen dramatisch an. Insofern bitte ich Sie, mir meinen Hang zum Zynismus nachzusehen.)
Verschiedene Formen einer Substanz
Manche Fotochemikalien kommen in verschiedenen Formen vor. Beispiele sind Soda sicc., Soda-Monohydrat und Soda krist. (Dekahydrat). Der Unterschied ist hier der Wassergehalt: Soda sicc. ist die wasserfreie Form und enthält kein Kristallwasser. Soda-Monohydrat enthält je Sodamolekül ein Wassermolekül und Soda krist. (Kristallsoda oder Dekahydrat) je Sodamolekül 10 Wassermoleküle. Wenn ich also von jedem dieser drei Stoffe 10 g auf der Waage habe, habe ich nur im ersten Fall 10 g Wirksubstanz, bei den Formen mit Kristallwasser um so weniger, je mehr Wasser enthalten ist. Für einige häufig vorkommende Substanzen ist in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet, wie man die Mengen umrechnen muss, wenn man die eine durch die andere ersetzt.
|
Substanz |
Diese Menge wasserfreie Form ist zu ersetzen durch |
diese Menge Gramm des Monohydrats |
oder diese Menge der kristallinen Form |
|
Soda |
1 |
1,17 |
2,7 |
|
Natriumsulfit |
1 |
2 |
|
|
Natriumsulfat |
1 |
2,3 |
|
|
Natriumthiosulfat |
1 |
1,6 |
Die kristallinen Formen, inbesondere von Natriumthiosulfat, das sehr gut in Wasser löslich ist, können interessante Wirkungen haben: Löst man sie in Wasser auf, so kühlt sich die Lösung stark ab. Dieser Abkühlungsvorgang kann beim Auflösen größerer Mengen so weit gehen, dass die Lösung gefriert und den Behälter, in dem man mischt, zum Platzen bringt. Es empfiehlt sich also, auch um Zeit zu sparen, zum Ansatz warmes Wasser zu verwenden, denn in kaltem Wasser lösen sich Kristalle nur sehr langsam.
Bei Auflösen der wasserfreien Formen in Wasser dagegen wird Wärme frei (vgl. Wasser auf Säure), und hier empfiehlt es sich folgerichtig, kaltes Wasser zu verwenden und immer die Wirksubstanz zum Wasser zu geben und nicht umgekehrt.
Temperaturumrechnung
In der Schule hat man Sie im Physikunterricht sicher mit der Kelvinskala gequält, und die meisten wissen, dass man von einer Temperatur in Kelvin (nicht: Grad Kelvin! Abgekürzt nur mit K, nicht °K) nur 273 (genauer 273,15) abziehen muss, um die Temperatur in Grad Celsius (°C) zu erhalten. Kelvin in Grad Celsius ist leicht umzurechnen, aber in der Fotografie leider unüblich.
Häufig kommt dagegen das in den USA noch immer übliche Grad Fahrenheit (°F) vor. Auf der Fahrenheit-Skala gefriert Wasser bei 32°F und kocht bei 212°F. Damit ist eigentlich alles gesagt.
Na gut, sagen wir es konkreter:
Um von °F in °C umzurechnen, subtrahieren Sie 32 und teilen Sie durch 1,8.
Um von °C in °F umzurechnen, multiplizieren Sie mit 1,8 und addieren Sie 32.
Damit ist klar: Die Standardtemperatur fotografischer Lösungen von 20°C wird auf der anderen Seite des großen Teiches 68°F betragen, ohne deswegen wärmer zu sein.
Literatur
Die meisten dieser Zusammenhänge sind zusammengestellt in:
Grant Haist, Modern Photographic Processing, Vol. 1, Wiley Interscience (Wiley Series on photographic sciences and technology), 1979, ISBN 0-471-02228-4
[m.W. leider lange vergriffen und nur noch in Antiquariaten zu haben]