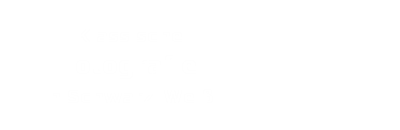Kolumne
Thomas Wollstein
Dez. 2000
|
Zusammenfassung:
Auf diese Weise sparen Sie Zeit und Wasser, ohne Ihre Bilder in Gefahr zu bringen. |
Es ist eine alte fotografische Weisheit (so alt, dass man vielleicht "photographisch" schreiben sollte), dass die optimale Haltbarkeit von SW-Fotos nur durch eine Zweibad-Fixage zu erreichen ist. Da das Verfahren sich aber immer noch nicht vollständig herumgesprochen hat, möchte ich es in Anbetracht seiner Wichtigkeit hier noch einmal kurz erläutern. Wer es schon kennt, kann den ersten Teil dieses Artikels getrost überspringen.
Zweibad-Fixage
In den meisten deutschen Dunkelkammer-Lehrbüchern wird wohl noch heute hauptsächlich die Einbad-Fixage erwähnt. Man setzt einfach ein Fixierbad an, wirft seine Bilder für eine vorgegebene Zeit hinein und wässert sie danach des langen und des breiten aus. Wenn man eine bestimmte Anzahl von Bildern fixiert hat, ist das Bad verbraucht, und es wird ein frisches angesetzt. Auch ich habe nach dieser Methode vor 25 Jahren angefangen, und dass meine damals vergrößerten Bilder noch heute intakt sind, wundert mich fast selbst.
Einbad-Fixage kann funktionieren, wenn man die Bäder nicht zu stark ausnutzt, birgt aber eine Gefahr: Die Fixage dient dazu, unbelichtetes und instabiles Silberhalogenid, das sich in Wasser fast nicht löst, in lösliche Verbindungen zu überführen und aus der bis dahin noch lichtempfindlichen Schicht zu lösen. Je weniger unverbrauchtes Thiosulfat und je mehr Silber im Fixierbad gelöst vorliegt (je mehr Bilder also schon fixiert wurden), desto häufiger passiert aber noch etwas anderes: Es bildet sich eine schwer lösliche Thiosulfatverbindung. Nutzt man also sein Fixierbad zu stark aus, sorgt man dafür, dass sich in der Schicht schwerlösliche, aber nicht dauerhaft stabile Silberverbindungen bilden, die auch durch noch so langes Wässern nicht entfernt werden. "Nicht dauerhaft stabil" heißt aber, dass diese Verbindungen irgendwann zerfallen und zu Verfärbungen des Bildes führen können.
Hier setzt die Zweibad-Fixage an: Die erwähnten schwer löslichen Verbindungen bilden sich in Gegenwart eines Thiosulfatüberschusses zu leicht löslichen zurück, also z. B. dann, wenn man das teilweise fixierte Bild in ein frisches Fixierbad bringt. Es bleiben dann nur (relativ) leicht auszuwässernde Silberverbindungen im Bild zurück.
|
|
Zweibad-Fixage: So geht´s! |
Warum funktioniert das? Ganz einfach: Fast das gesamte unbelichtete Silber wird durch Bad 1 aus der Schicht gelöst und bleibt in diesem Bad. Bad 2 bleibt bis zuletzt fast jungfräulich.
|
|
Vorsicht Chemie! |
So, jetzt wissen Sie, warum Sie die Zweibad-Fixage nutzen sollten und wie sie funktioniert. Das Gesagte gilt für PE/RC-Papiere wie für Barytpapiere. Im nächsten Abschnitt verrate ich Ihnen, warum Sie Barytpapier möglichst kurz fixieren sollten.
Blitzfixage!
Als ich mit dem Vergrößern begann, war der Term "Fixiersalz" zumindest in der deutschen Fachliteratur noch gleichbedeutend mit Natriumthiosulfat, und die Fixierzeit betrug typischerweise 5 bis 10 Minuten. Wer das heute noch tut, ist selber Schuld, wenn er ewig wässert und seine Bilder trotzdem nicht halten. In 10 Minuten hat das Fixiersalz viel Zeit, in den Papierfilz einzudringen. Ammoniumthiosulfat-Fixierbäder hoher Konzentration kommen mit 30 bis 60 s (!) Fixierzeit aus. Dabei bleibt dem Fixierbad zwar die Zeit, das Bild zu fixieren, aber der Papierträger wird nicht vollkommen damit durchtränkt. Der Erfolg liegt auf der Hand: Was nicht erst ins Papier eindringt, muss auch nicht herausgewaschen werden! Mit "hoher Konzentration" ist gemeint, dass Sie z. B. bei Ilford Hypam nicht auf die für Papier genannte Konzentration 1+9 verdünnen, sondern auf die für Film spezifizierte Verdünnung 1+4. Ilford empfiehlt diese Prozedur in den Datenblättern seiner Multigrade Barytpapiere [4] zur Erreichung einer möglichst kurzen Waschzeit und optimaler Haltbarkeit.
|
|
Blitzfixage |
Von diesem Schnellfixierbad setzen Sie am besten nach der oben beschriebenen Methode zwei Bäder an und fixieren die Hälfte der Zeit in Bad 1, die Hälfte in Bad 2.
Sparen Sie Zeit und Wasser: 5 Minuten Wässern sind genug!
Es ist so offensichtlich, dass sich vermutlich noch niemand gefragt hat, warum man Filme und RC-Papiere nur 5 Minuten wässern muss, für Barytpapiere aber immer noch Zeiten von 30 bis 60 Minuten empfohlen werden. Es liegt natürlich am dicken Papierfilz, aus dem das Fixierbad nur schwer herauszuwaschen ist. Was muss man also tun, um die Waschzeiten kurz zu halten? Richtig: Man muss das Fixiersalz aus dem Papier heraushalten. Das lässt sich durch eine möglichst kurze Fixierzeit erreichen. Es gibt Versuchsreihen (z. B. [2] und [3]), die belegen, dass bei der Nutzung von Schnellfixierbädern mit einer Fixierzeit von 30 bis 60 Sekunden eine Wässerung von 5 Minuten schon ausreichen kann, um einen Restthiosulfatgehalt von unter 5 mg/cm2 zu erreichen, der in manchen Veröffentlichungen schon als archivfest angesehen wird. Es lässt sich auch zeigen, dass man eine lange Fixierzeit nicht einfach durch eine lange Wässerungszeit kompensieren kann, denn es wird als abschreckender Gegenversuch in [2] berichtet, dass ein lange fixiertes Bild nach zweitägiger (!) Waschzeit erst den Restthiosulfatgehalt erreichte, den ein kurz fixiertes bereits nach 12 Minuten hatte. (Leider ist bei diesem Versuch die Wassertemperatur nicht angegeben, denn auch sie hat einen wichtigen Einfluss auf den Wässerungserfolg. Siehe auch weiter unten.) Abgesehen davon tut überlanges Wässern keinem Bild gut: Die Schicht wird verletzlich, evtl. im Träger enthaltene optische Aufheller werden ausgelaugt [3], und im schlimmsten Fall löst sich die Schicht vom Papierträger [1].
Als zweite Maßnahme ist eine chemische Wässerungshilfe zu empfehlen. Ein saures Milieu sorgt dafür, dass sich die Poren des Papiers schließen, was die Wässerung behindert. Ein alkalisches Milieu andererseits öffnet die Poren des Papiers. Zudem ist es so, dass bestimmte Ionen die Tendenz haben, sich mit den Thiosulfationen im Papier auszutauschen. Wenn die ins Papier hineindiffundierenden Verbindungen leichter ausgewaschen werden können als Thiosulfat, beschleunigt auch das die Wässerung. Aus diesem Grund ist (so [6]) z. B. Meerwasser mit seinem Salzgehalt zum Auswässern günstiger als Leitungswasser. Als einfachsten, billigsten und dennoch gut wirksamen Auswässerungsbeschleuniger kann man eine 1%ige Sodalösung (10 g Soda sicc. auf 1 l Wasser) verwenden. Dieses Verfahren wird z. B. von Agfa [5] empfohlen. Noch etwas wirksamer ist eine 2%ige Natriumsulfitlösung. (Dies allerdings nicht wegen der höheren Konzentration, sondern wegen des beschriebenen Ionenaustauschs.) Bequemer, aber auch teurer sind fertig erhältliche Wässerungshilfen wie z. B. Ilford Washaid, AMALOCO H 8, Tetenal Lavaquick und Kodak Hypo Clearing Agent.
Eine andere Art von Wässerungshilfen sind so genannte "Thiosulfatkiller", die Thiosulfat zu leichter löslichem Sulfat oxidieren. In einfachster Form könnte man dies z. B. mit Wasserstoffperoxid erreichen. Die Meinungen über solche Produkte sind geteilt. Man kann nie ganz sicher sein, ob die Oxidationsmittel nicht auch das Papier und das Silberbild selbst angreifen. Von solchen Produkten würde ich daher abraten.
|
Verwenden Sie nach dem Fixieren einen Auswässerungsbeschleuniger! |
Abzuraten ist von Härtern oder Härtefixierbädern. Diese gerben die Gelatine der Emulsion, was einerseits Vorzüge hat, da sie (hauptsächlich während der Verarbeitung) mechanisch stabiler ist und folglich nicht so leicht beim Manipulieren des Bildes Schaden nimmt. Die Kehrseite aber ist, dass die Wässerung (und auch Tonung) behindert wird. Ilford z. B. rät ausdrücklich von der Verwendung von Härtern ab [4].
|
Verwenden Sie keinen Härter! |
Eine heiße Sache: die Wässerungstemperatur
Viele Empfehlungen zur Wässerung schweigen sich leider zum Thema Wassertemperatur vornehm aus. Dafür kursieren aber endlos viele Latrinenparolen, so z. B. die Empfehlung, man möge bei 15°C doppelt solange wässern wie bei 20°C u. ä. Auch in dieser Hinsicht gibt der alte Artikel in der Foto Hobbylabor von 1988 [3] noch einiges her: Aus den veröffentlichten Messdaten ergibt sich, dass man die Wässerung ziemlich beschleunigen kann, wenn man bei 30°C wässert. Um denselben Effekt zu erzielen, muss man bei 15°C doppelt solange wässern. (Aufgemerkt: Die Temperaturdifferenz für die Verdopplung beträgt satte 15°C!) Andere Veröffentlichungen (z. B. [8]) raten von Wässerungstemperaturen über 25°C ausdrücklich ab, da bei diesen Temperaturen die Bildoberfläche weich und extrem verletzlich wird.
Wenn man die präsentierten Daten noch ein wenig weitergehend auswertet als es die Autoren damals getan haben, findet man aber noch eine interessante Schlussfolgerung (deren etwas längere Erklärung weiter unten Sie gerne überlesen können):
|
Bei "kalter" Wässerung lohnt langes Waschen nicht! |
Amüsant finde ich die oft gegebene Empfehlung, man solle bei 20°C wässern. Wenn man ein Labor zur Verfügung hat, in dem man die Zuflusstemperatur regeln kann, ist das eine feine Sache, aber leider hat man als Hobbyfotograf meist nur einen normalen Wasseranschluss mit einer oft nur ungenau regelbaren Mischbatterie. Dann lassen sich die 20°C Wassertemperatur meist nur bei stehender Wässerung einfach erreichen. Die Temperatur des Leitungswassers schwankt im Jahreslauf über einen gewissen Bereich. Als typischer Wert hat sich bei mir zuhause 15°C erwiesen. Ich habe mich daher gefragt, wie denn die Wässerungswirkungsgrade bei verschiedenen Temperaturen zueinander im Verhältnis stehen. Als Bezugswert habe ich 20°C verwendet. Das Ergebnis zeigt Bild 1, basierend auf den Daten in [3]. Die obere Kurve zeigt, dass bis zu einer Wässerungszeit von 20 Minuten eine Wässerung bei 15°C ziemlich ähnliche Resultate zeigt wie eine bei 20°C (auch wenn man den Wert von 1 [also identische Wirksamkeit] bei 20 Minuten vielleicht nicht wörtlich nehmen sollte). Bei längerer Wässerung ist wärmeres Wasser deutlich wirksamer. (Man beachte jedoch die Warnung hinsichtlich der Verletzlichkeit der Bilder bei hohen Wässerungstemperaturen weiter oben!) Wie erwartet läuft der 15°C-Wert nach oben weg, was bedeutet, dass das Bild mehr Restthiosulfat enthält als ein mit 20°C gewässertes, und der 30°C-Wert läuft nach unten weg, das Bild enthält also weniger Thiosulfat als ein mit 20°C gewässertes. Diese Trends selber sind genau das, was man erwartet, aber interessant ist, wie steil die 15°C-Kurve nach oben abknickt. Das bedeutet, dass sie überproportional an Wirksamkeit verliert.
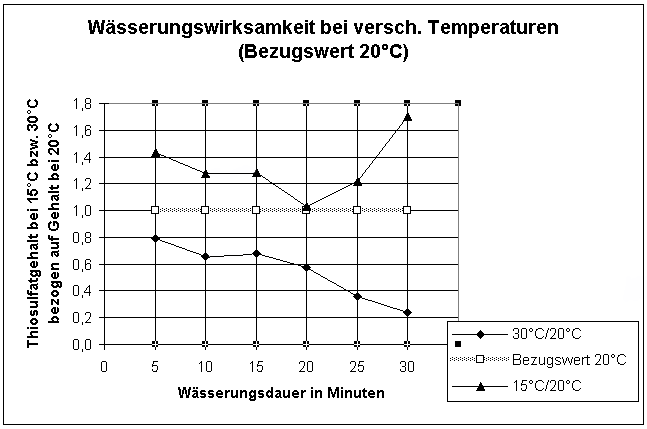
Bild 1: Die Kurven zeigen den Restthiosulfatgehalt bei 15°C und 30°C im Vergleich zu einer Wässerung bei 20°C. Ein Wert von 1 bedeutet, dass der Restthiosulfatgehalt genauso groß ist wie bei einer 20°C-Wässerung. (M. a. W.: Die gerasterte Linie beim Wert 1 ist die Bezugskurve.)
Lt. [8] zeigen die derzeit besten Forschungsergebnisse, dass man selbst dann, wenn man bei 4°C wäscht, die Waschzeit gegenüber dem 20°C-Wert höchstens verdoppeln muss. Diese Aussage passt zu der eben gezogenen Schlussfolgerung, dass es sich nicht lohnt, übermäßig lange zu waschen, um eine niedrige Wassertemperatur auszugleichen.
"Fließende" oder "stehende" Wässerung?
Noch ein Punkt, der in vielen Anleitungen zur Wässerung nicht befriedigend behandelt wird, ist der Durchfluss bei der so genannten "fließenden" Wässerung. Die Versuche in [3] wurden mit 6 Liter je Minute durchgeführt. Der beste Tipp, den man hierzu geben kann ist, sich an die Empfehlungen des Herstellers des eigenen Waschers zu halten. Der wichtigste Grundsatz bei jeder Wässerung ist allerdings:
|
|
Wenig Wasser in innigen Kontakt mit dem Bild gebracht hilft mehr als viel Wasser, das keine Zeit hat, sich mit dem Bild ins Lösungsgleichgewicht zu setzen. |
Aus diesem Grund ist die sparsamste Wässerung die "stehende": Stecken Sie ein Bild in eine Schale soviel Wasser, dass es gut schwimmt und belassen Sie es unter häufigem Bewegen (das kann auch eine billige Aquarienpumpe erledigen) für 5 Minuten darin. Wechseln sie das Wasser 10 Mal. Mehr an Archivfestigkeit können Sie auch sonst praktisch nicht erreichen. Inzwischen ist man sich auch im Klaren, dass es durchaus möglich ist, ein Bild zu ausgiebig zu wässern. (Diesen Punkt werde ich in meinem nächsten Beitrag noch einmal kurz aufgreifen.)
Was heißt denn eigentlich "archivfest"?
Wenn ich das nur wüsste!
Vieles an dem ganzen Gerede von "archivfesten" Bildern steht auf ziemlich wackligen Beinen. Bisher weiß nämlich niemand genau, wie viel Restthiosulfat ein Bild verträgt. Nicht mehr ganz neue Forschungsergebnisse (siehe [3] und [7]) deuten aber auch darauf hin, dass ein bisschen Restthiosulfat das Bild sogar (vermutlich durch Bildung von Silbersulfid) vor dem Zerfall schützen kann. Stephen Anchell relativiert in [1] die ganze Diskussion zum Thema Wässern mit dem Hinweis auf viele hervorragend erhaltene Bilder von Meisterphotographen, die "wegen ihrer schlampigen Arbeitsweise schon lange von der Fotografenschule hätten fliegen müssen".
Halbwegs sicher weiß man:
- RC-Papiere sind empfindlicher als Barytpapier, weil aufgrund der Sperrschicht zwischen Schicht und Träger eventuell gebildete lösliche Silberverbindungen nicht aus der Bildschicht herausdiffundieren können (womit sie teilweise entschärft wären).
- Die größte Gefahr droht SW-Bildern (anderen wahrscheinlich auch, aber das ist bei diesem Beitrag nicht mein Thema) nicht vom Restthiosulfat, sondern von Luftverschmutzungen und ganz besonders von Licht. (Eine Besonderheit von RC-Papieren in diesem Zusammenhang werde ich im nächsten Beitrag aufgreifen.)
- Eine wirklich archivfeste Lagerung ist - eigentlich ein Gemeinplatz - nur in einem abgeschlossenen Archiv möglich. Bei normaler Lagerung und Handhabung der Bilder (inklusive Herumzeigen) oder bei ausgestellten Bildern kann davon sowieso keine Rede sein.
- Als Daumenwert für halbwegs "archivfeste" Bilder kann man einen Restthiosulfatgehalt von 5 mg/cm2 ansehen.
Schlussfolgerungen ...
... müssen Sie eigentlich selber daraus ziehen. Pragmatisch erscheint es mir,
- bei der Temperatur zu wässern, mit der das Wasser bei uns aus der Leitung kommt und
- mich mit einer knappen halben Stunde Wässern zu begnügen.
Im Detail finden Sie meine Empfehlung im letzten Abschnitt.
Testen Sie selbst!
Wenn Sie gerne experimentieren, können Sie auch einen der einfachen Tests auf Restthiosulfat durchführen, die ich nachfolgend zusammengestellt habe. Allerdings wird zu keinem dieser Tests der damit messbare Restthiosulfatgehalt quantitativ angegeben. Diese Tests funktionieren eher nach dem Grundsatz: Wenn der Test anspricht, hat die Wässerung definitiv nicht gereicht. Um zu prüfen, ob Sie auch wirklich die Testlösung richtig angesetzt haben, sollten Sie daher einmal mit Absicht ein Foto zu kurz wässern und sich ansehen, wie der Test reagiert.
Test 1: Prüfung auf Restthiosulfat im Waschwasser
Bei diesem Test versetzen Sie eine kleine Menge des letzten Waschwassers mit einer Testlösung.
|
|
Vorsicht Chemie! Nur für Experimentierfreudige. |
Test 2: Prüfung auf Restthiosulfat im Papier
Hierzu brauchen Sie die Kodak Hypo Test Solution HT-2, die Sie sich leicht selber ansetzen können. Beachten Sie dabei etwas mehr als die üblichen Vorsichtsmaßregeln für den sicheren Umgang mit Chemikalien, denn Eisessig klingt nur nach Salatsoße. In Wirklichkeit ist er sehr aggressiv und reizt Haut und Atemwege. Was passiert, wenn Sie ihn ins Auge bekommen, möchte ich mir nicht ausmalen. Tragen Sie also eine Schutzbrille und Laborhandschuhe, und sorgen Sie für gute Belüftung. Beachten Sie auch, dass man immer die konzentrierte Säure in ein größeres Volumen Wasser gießt und nicht etwa umgekehrt.
|
|
Vorsicht Chemie! Nur für Experimentierfreudige. |
Fixage und Wässerung im Überblick
In Anlehnung an die zitierten Veröffentlichungen würde ich zusammenfassend folgendes Verfahren empfehlen:
|
Verarbeitungsschritt |
Zeit |
|
Stoppbad |
nach Herstellerempfehlung bzw. eigener Erfahrung |
|
Fixage in Schnellfixierbad (z. B. Ilford Hypam 1+4), Bad 1 |
30 s |
|
Fixage in Schnellfixierbad (z. B. Ilford Hypam 1+4), Bad 2 |
30 s |
|
Spülen (z. B. in einer großen Schale mit frischem Wasser) |
30 s |
|
Auswässerungsbeschleuniger (z. B. 1%ige Sodalösung, 2%ige Natriumsulfitlösung, Ilford Washaid, AMALOCO H 8, Tetenal Lavaquick oder gleichwertig) |
nach Empfehlung des Herstellers (z. B. 2-3 Minuten für Sodalösung) |
|
Wässerung in fließendem Wasser bei Leitungstemperatur |
20 bis 30 Minuten |
[1] Stephen Anchell, The Variable Contrast Printing Manual, Butterworth-Heinemann 1997, ISBN 0-240-80259-4
[2] Heinz Richter, Comparison of Fixing Methods in f32, http://www.f32.com/articles/art021.htm, nicht datierter Artikel (Stand 27. Oktober 2000); Anmerkung: Leider nicht mehr online.
[3] Dieter Findeisen, KS, Katzenwäsche? Barytpapier richtig wässern, Foto Hobbylabor Nr. 5/88, S. 10-14
[4] Ilford-Datenblätter http://www.blende7.at/datenblaetter/ilford/
[5] Agfa-Veröffentlichung "Neueste Technik für ein klassisches Prinzip - Agfa Schwarzweiß" (undatiert)
[6] Tim Rudman, The Photographer's Master Printing Course, Butterworth-Heinemann 1995, ISBN 0-240-80437-6
[7] Ctein, Post Exposure - Advanced Techniques for the Photographic Printer, Focal Press 2000, ISBN 0-240-80229-3
[8] Roger Hicks, Frances Schultz, The Black and White Handbook - The Ultimate Guide to Monochrome Techniques, David & Charles, 1997. ISBN 0-7153-0572-7
Darf ich mich vorstellen?
Thomas Wollstein
Nov. 2000
Als mich Herr Löffler fragte, ob ich Lust hätte, eine Kolumne beizusteuern, war ich zunächst überrascht, und ich fühlte mich natürlich auch geschmeichelt. Eine Menge brillanter Ideen gingen mir durch den Kopf, mit denen ich mich Ihnen, liebe Leser, vorstellen könnte. Aber letztendlich liegt mir Selbstdarstellung in dieser Form nicht, also belasse ich es bei einer "neutralen" Vorstellung: Ich heiße Thomas Wollstein, bin Physiker und fotografiere, entwickle und vergrößere seit ungefähr 25 Jahren, wobei ich eine ausgesprochene Vorliebe für Schwarzweiß-Fotografie und nicht ganz so gängige Verfahren (z. B. Infrarot, Stereo, alte Verfahren) habe, die mir Raum für Experimente lassen.
Ich habe mir vorgenommen, in meinen Beiträgen bevorzugt solche Themen aufzugreifen, bei denen ich im Rahmen meiner Recherchen im Internet schon oft bemerkt habe, dass es Wissensdefizite oder Missverständnisse bei vielen Fotografen gibt. Als Physiker habe ich einen gewissen theoretischen Hintergrund, den ich nicht vergessen kann. Ich werde mir Mühe geben, Sachverhalte hier so zu erklären, dass auch weniger naturwissenschaftlich-technisch geprägte Leser etwas davon haben, ohne dabei physikalischen Blödsinn zu erzählen.
|
|
Vorsicht Wissenschaft! |
|
|
Schlussfolgerungen, die mir besonders wichtig erscheinen, werde ich hervorheben. |
Doch nun zum ersten Mal zur Sache:
Stolperstein Kornscharfsteller
|
Zusammenfassung: |
Immer wieder werden Kornscharfsteller als das Nonplusultra bei der Scharfstellung gepriesen, und in manchen Internet-Foren werden die Verdienste des einen und Macken des anderen Gerätes heiß diskutiert. Aber alle Kornscharfsteller, gleich ob billig oder teuer, können beim Schwarzweißvergrößern zu Einstellfehlern führen, die ich nachfolgend beschreiben möchte. Ich werde Ihnen auch sagen, wie Sie prüfen können, ob Sie von dem Problem betroffen sind oder nicht und Ihnen zuletzt schonend beibringen, dass das Problem teilweise unlösbar ist. Sollten Sie in Farbe vergrößern, brauchen Sie hier nicht weiterzulesen. Vergrößern Sie aber in Schwarzweiß und haben sich gewundert, warum Ihre Fotos ein gewisse Unschärfe aufweisen, obwohl Sie doch sorgfältigst mit Ihrem Kornscharfsteller fokussiert haben, finden Sie in diesem Artikel vielleicht eine Erklärung.
Es gibt zwei Probleme, ein einfaches und ein schwierigeres. Zunächst das einfache:
Haben Sie einmal versucht, einen Gegenstand durch ein tiefblaues Filter anzuschauen, oder ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie schwierig es ist, eine blaue Leuchtreklame scharf zu sehen? Es wird zumindest einige Anstrengung kosten, Ihre Augen richtig scharf zu stellen, manchmal gelingt es Ihnen auch gar nicht. Das liegt daran, dass beim menschlichen Auge (und übrigens bei praktisch allen anderen Linsensystemen auch) blaues Licht in einer anderen Entfernung hinter der Linse fokussiert wird als rotes. Wenn Sie also in rotem Licht etwas scharf sehen und jemand nun die rote Lampe aus- und eine blaue einschaltet, müssen Sie neu scharf stellen, auch wenn die Entfernung zum betrachteten Gegenstand gleich bleibt.
|
|
Vorsicht Fachsprache! |
Bei Kornscharfstellern, bei denen auf ein "Luftbild" scharfgestellt wird (im Gegensatz zu solchen, bei denen auf ein auf eine Fläche projiziertes Bild scharfgestellt wird) kann dieser Effekt dazu führen, dass man um bis zu einem Zentimeter daneben liegt, weil an der scharfen Abbildung des Korns im Scharfsteller das menschliche Auge mit seinem Farbfehler beteiligt ist, an der Abbildung auf das Papier aber nicht. Haben Sie mit einem Mattscheiben-Scharfsteller scharf gestellt, tritt der Effekt nicht auf, denn das Korn wird in der Mattscheibenebene und damit auf dem Papier scharf abgebildet. Es ist halt nur das Auge, das Probleme hat, die Mattscheibe in blauem Licht scharf zu sehen.
|
|
Lösen Sie dieses Problem, indem Sie das Blaufilter, das bei manchen Kornscharfstellern beigefügt ist (angeblich weil Fotopapier bevorzugt auf blaues Licht reagiert) nicht benutzen. Bei den heutigen Papieren verursacht dieses Filter möglicherweise mehr Ärger als es Nutzen bringt. |
Der o. g. Fehler tritt bei festgraduiertem Papier genauso auf wie bei kontrastvariablem. Der zweite - wesentlich unangenehmere - Fehler tritt ausschließlich bei kontrastvariablem Papier auf:
Auf den Punkt gebracht läuft er darauf hinaus, dass die Fokusebene, die wir mit unseren Augen sehen, eine ganz andere sein kann als die, die das Papier sieht, weil wir das Licht, das das Papier am stärksten schwärzt, gar nicht sehen. Abweichungen von bis zu 15 mm werden berichtet [1]. Auch dies liegt an der erwähnten longitudinalen chromatischen Aberration, aber an der des Vergrößerungsobjektivs, nicht an der unseres Auges: Während die meisten guten Vergrößerungsobjektive für den Bereich des roten, grünen und blauen Lichtes hinreichend gut korrigiert sind und dort nur ein geringer Farbfehler auftritt, sieht es mit der Korrektur im Ultravioletten (UV) oft nicht so gut aus. Andererseits reagieren moderne kontrastvariable Papiere zum Teil auch auf (für das Auge nicht mehr sichtbares) ultraviolettes Licht, und manche Lichtquellen strahlen nennenswerte Mengen davon ab.
Wie merken Sie, ob Sie dieses Problem betrifft? Suchen Sie sich ein körniges Negativ, stellen Sie es (ohne Blaufilter!) mit Ihrem Kornscharfsteller sorgfältig scharf, und vergrößern Sie es bei der optimalen Öffnung Ihres Vergrößerungsobjektives (vermutlich zwischen 4 und 5,6 bei Kleinbild, bei Mittel- und Großformat vermutlich 5,6 bis 8 bzw. 8 bis 11) mit den Filtern für die Gradationen 0 (oder 00) und 4 (oder 5) so stark, dass Sie das Korn gut sehen können. Mit einiger Sicherheit wird die Vergrößerung bei der weichen Gradation scharf sein, denn dort wird UV weitestgehend ausgefiltert, weil der weiche Anteil der kontrastvariablen Emulsion durch Licht längerer Wellenlängen belichtet wird. Bei der harten Vergrößerung jedoch kommt viel blaues und möglicherweise ultraviolettes Licht auf das Papier, und dann kann es passieren, dass bei unveränderter Fokussierung das Bild unscharf wird. Ähnlich unscharf wird das Bild sein, wenn sie eine Vergrößerung ganz ohne Filter anfertigen (meist entspricht die Gradation dann ungefähr 2), denn auch dort wird ja UV nicht ausgefiltert. Zu den Einflussfaktoren, die das Ausmaß des Problems beeinflussen, gehören:
- die Lichtquelle (dadurch, dass sie mehr oder weniger ultraviolettes Licht abstrahlt),
- das Objektiv (durch seine Korrektion und Durchlässigkeit für ultraviolettes Licht),
- das verwendete Papier (durch die Lage seiner größten Empfindlichkeit innerhalb des Spektrums).
In Konsequenz heißt das, dass Sie für alle möglichen Konfigurationen testen müssen, wenn Sie ein Problem feststellen. In [1] wird berichtet dass z. B. mit Kodak Polymax und Ilford Multigrade IV die größten Verschiebungen mit einem bestimmt nicht schlechten Schneider Computar und vergleichbare mit einem El-Nikkor und einem Rodenstock Rodagon entstanden. Praktisch keine Verschiebung war bei allen Objektiven bei Agfa Multicontrast Premium zu finden, vermutlich weil dieses Papier sein Empfindlichkeitsmaximum dort hat, wo auch das Auge noch gut sieht.
Wie können Sie sich helfen? Eine schnelle und schmutzige - aber leider auch nur halb wirksame Lösung - besteht in einem Kodak Filter 2B. Dieses Filter reduziert das Problem auf die Hälfte, indem es den größten Teil der ultravioletten Strahlung ausfiltert, es verlängert allerdings die Belichtungszeiten um 50 %. Eine aufwendigere und saubere Lösung wäre es, die Verschiebung zu messen und zu korrigieren. Sie brauchen dazu einen Stapel Pappe und viel Geduld. Verfahren sie wie folgt:
Nutzen Sie ein möglichst körniges Negativ.
- Legen Sie Ihren Vergrößerungsrahmen auf einen 5 mm hohen Stapel Pappe, fokussieren Sie ganz genau.
- Fertigen Sie eine Vergrößerung bei der optimalen Öffnung Ihres Vergrößerungsobjektives (s. o.) an.
- Fertigen Sie eine weitere Vergrößerung an, bei der Sie die Pappe weglassen, aber die Fokussierung nicht ändern.
- Fertigen Sie eine weitere Vergrößerung an, aber mit 10 mm Pappe drunter. Auch hier wird die Fokussierung nicht geändert.
- Fertigen Sie noch eine Vergrößerung mit dem ursprünglichen 5-mm-Stapel an.
Beurteilen Sie die Vergrößerungen möglichst unter einer guten Lupe. Die Vergrößerungen nach 2 und 5 müssen gleich scharf sein. (Sonst haben Sie einen Fehler gemacht, oder Ihr System hat sich selbsttätig verstellt.) Wenn sie gleichzeitig die schärfsten sind (d. h. 3 und 4 also weniger scharf sind als 2 und 5), haben Sie das große Los gezogen. Sie haben das Problem nicht, oder es ist nicht nennenswert. Ist entweder 3 oder 4 schärfer als 2 und 5, haben Sie das Problem und der Spaß fängt erst richtig an, denn Sie müssen praktisch für jedes Papier und jeden Vergrößerungsmaßstab mit jedem Objektiv die nötige Korrektur finden. Sie finden diese nur durch Versuch und Irrtum, indem Sie nach dem gerade beschriebenen Verfahren verschiedene Pappstapelhöhen testen und die als Korrektur verwenden, bei der Ihnen die Fotos am schärfsten erscheinen. Gegen unscharfe Vergrößerungen ohne Filter gibt es kein echtes Heilmittel.
|
|
Eine einfache und dennoch vollständige Lösung des Problems gibt es nicht. |
Übrigens hat Rodenstock das Problem durch eigene Messungen bestätigt und festgestellt, dass es nicht möglich sei, die Objektive bis in den UV-Bereich hinein hinreichend zu korrigieren, ohne die Abbildungsqualität im sichtbaren Bereich zu verschlechtern. Die Lösung kann also höchstens von den Papierherstellern kommen, indem diese die Empfindlichkeit der kontrastvariablen Papiere nicht zu weit in das nicht sichtbare Spektrum ausdehnen.
Literaturhinweis:
[1] Ctein: Post Exposure, Advanced Techniques for the Photographic Printer, Focal Press, 2000, ISBN 0-240-80437-6
Inzwischen kostenlos als Downoad von der Seite des Autors: http://ctein.com/booksmpl.htm